…“normal” gibts schon genug.”
Einerseits ist so eine Aussage hochtoxisch.
Sie setzt das Leben mit einer Behinderung in einen Wettbewerb, der aufwendig zu kompensierende Behinderungen gar nicht mitdenkt und negiert die Relevanz von Normalität bzw. die Relevanz, die es hat als “normal” gelesen zu werden.
Andererseits gibt es aber doch Dinge, die ich ohne die Behinderungen in meinem Leben, nicht so gelernt hätte, wie ich sie gelernt habe. Und ohne die ich heute manchmal erheblich mehr Unterstützung bräuchte, mehr auffallen würde und auch abhängiger von Menschen wäre. (Doch natürlich ist die Behinderung hier nur der Anlass zur Entwicklung in anderen Kontexten vorteilhafter Fähigkeiten – nicht die Fähigkeit selbst!)
Wir haben gestern am Inklusionscamp in Dortmund teilgenommen und in einer Session über Kommunikation als Herausforderung in der Bildung gesprochen.
Beziehungsweise war das mein Vorhaben, das ich dann aber in etwas umwandelte, das sich auf konkrete Lösungen bezog, was auch gut und hilfreich war.
Aber.
In ebenjener Session wurde mir das gesagt. Dass meine Sicht auf die Dinge, gerade im Bereich der Kunst und Gestaltung etwas sein könnte, das mich abhebt und interessant macht.
Später auf dem Heimweg dachte ich, wie ungut das ist.
In der Kunst geht es miruns um Ausdruck. Manchmal um Abbildung. Manchmal darum, sich Dinge genau ansehen zu können. Es geht aber weder prim- noch sekundär darum angesehen zu werden. Ausgesucht zu werden.
Es geht mehr darum verstanden zu werden. Verbindungen zu schaffen.
Und heute einen Tag später denke ich, dass der Kunst und Kulturbetrieb eben doch wieder ein Betrieb ist.
Und ich das ausgeblendet habe gerade weil meine Wahrnehmung und meine Ausdrucksformen dort überdurchschnittlich oft ge.wert.schätzt werden.
Gerade weil ich oft mit Gewinn daraus hervorgehe. Vielleicht, weil ich einen Vorteil habe, den andere Menschen nicht haben.
Daneben sind und Kunst- und Kulturangebote nichts, was in meiner gesellschaftlichen Schicht passiert. Beziehungsweise nicht in der Form, dass es üblich ist regelmäßig ins Theater, ins Museum oder in Galerien zu gehen.
“Meine Leute” putzen die Toiletten in Galerien oder verkaufen als Aushilfe die Tickets dazu. “Meine Leute” studieren Schauspiel und tingeln zwischen Bühne und Burgerbraterei. “Meine Leute” machen Kunst auf Kopierpapier und teilen sie Instagram, bevor sie sie ins Altpapier geben.
Ich schreibe lieber “freie Autorin” auf meine Selbstdarstellung als “Künstlerin”, damit ich nicht als jemand gelesen werde, di_er entweder Geld hat oder darauf hinarbeitet mal (viel) Geld für etwas zu bekommen, das eigentlich jede_r machen könnte, worin aber nur wenige anerkannt und gewertschätzt werden.
Vielleicht ist das Teil meiner prekären Sozialisierung und damit Teil des Problems, das Kunst und Kultur hat.
Aber was soll ich sagen – ich muss zwischen Kunstkonsum und Kunstproduktion entscheiden. Entweder gehe ich ins Kino oder Theater oder kaufe mir drei vier mittelgroße Leinwände bei Xenos. Entweder lerne ich für meine schulische Berufsausbildung oder ich fahre zu Barcamps und anderen Veranstaltungen um zu netzwerken.
Prekäre Verhältnisse werden in so mancher neuen Kunst zur Performance pervertiert und damit nicht mehr als belastende (strukturelle) Behinderung, sondern als kreative Challenge, die – mit genug Einfallsreichtum begegnet – neue, bessere, besondere Fähig- und Fertigkeiten als Belohnung verheißt, dargestellt.
Diese neue Kunst ist es für mein Gefühl auch zunehmend, die sich behinderten /Künstler_innen/mit Behinderungen öffnet. Aus der gleichen Idee von Bereicherung und Kreativitätsvermehrung durch Teilhabe an den Kämpfen von Menschen, die sich ihre Kämpfe nicht aussuchen können.
Das Wort dazu ist “Inspirationporn” und ausgeblendet wird dort die Unfreiheit behinderter /Menschen/ mit Behinderungen bzw. wird die Auseinandersetzung damit vermieden.
Thema “inklusiver Künste” wird oft die Behinderung, die an den Personen verortet wird. Das kann eine Blindheit genauso wie ein Autismus sein – seltenst jedoch der Umstand, dass die behinderte /Person/ mit Behinderung sich kaum die Materialien und Assistenzen für ihre Kunstproduktion leisten kann und – aller guten Kompensationen zum Trotz – auch oft darum kämpfen muss überhaupt etwas mehr zu er_schaffen, als die Aufrechterhaltung des eigenen Lebens.
Es ist ein Ding geworden, als behinderte /Person/ mit Behinderung die an sich verortete Behinderung zu thematisieren. Nichts dagegen – aber das ist kein “inklusiver Kunst- und Kulturbetrieb”.
Einen solchen würde ich persönlich daran erkennen, dass ich erst in der Auseinandersetzung mit der Kunst selbst oder der Person hinter der Kunst etwas von den Behinderungen, die zur Erschaffung des Stücks zu kompensieren waren, erfahre. Und zwar als ganz üblicher Teil der Präsentation – und nicht als herausgestelltes Merkmal ebenjener Kunst.
Die Behinderungen mit denen Menschen leben, sind keine besonderen Merkmale der Personen.
Sie sind Merkmale der Normalität, die sie leben.
Diese Normalität auszudrücken, passiert wohl kaum in einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Prestige.
Viel mehr ist es doch so, dass diese Normalität auszudrücken und mit.zu.teilen, ein noch immer unterschätzter und nachwievor exklusivierter Beitrag zur Inklusion ist, der von behinderten /Menschen/ mit Behinderung selbst kommt.
In diesem Sinne weiter zu arbeiten, darin hat mich das Barcamp gestern sehr bestärkt.
Nicht, weil ich es als Vorteil begreife mit Behinderungen leben und infolge dessen immer wieder kreativ in der Lösungsfindung sein zu müssen, sondern weil mir noch einmal bewusster wurde, dass es noch ganz viel mehr Bewusstsein für verschiedene Normalitäten braucht. Auch in der Kunst und ihren Betrieben.
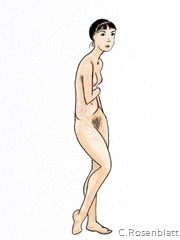 Ich habe meine Momente, in denen ich aus der Dusche klettere und innehalte, um den feinen Härchen auf meiner Haut dabei zuzuschauen, wie sie sich aufrichten.
Ich habe meine Momente, in denen ich aus der Dusche klettere und innehalte, um den feinen Härchen auf meiner Haut dabei zuzuschauen, wie sie sich aufrichten. Gibt es eine Möglichkeit die 60er Jahre nachzuempfinden? Oh ja- einfach mal dem Ersten dabei zusehen, wie er versucht sich dem Thema sexueller Vielfalt anzunehmen.
Gibt es eine Möglichkeit die 60er Jahre nachzuempfinden? Oh ja- einfach mal dem Ersten dabei zusehen, wie er versucht sich dem Thema sexueller Vielfalt anzunehmen.