„Je stressiger es im Alltag wird, desto mehr Struktur brauchen wir, um zu funktionieren.“ Das klingt für die meisten Leute total logisch und nachvollziehbar. Klar, wer viel vorhat, ist immer gut beraten sich einen Plan zu machen, um gut zu arbeiten oder Abläufe zu gewährleisten.
Für mich beginnt der Stress in „stressiger Alltag“ schon in dem Moment, in dem ich weiß, dass Dinge passieren werden, die üblicherweise nicht passieren. Und zwar nicht, weil sie passieren, sondern weil das Passieren dieser Dinge alles verändert und damit auch sämtliche Ressourcen und Stützen des Alltags beeinflusst. Was bedeutet, dass ich mich nicht nur um die passierenden Dinge, sondern auch ihre Wirkung auf mich kümmern muss.
Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagespläne sind mir noch nie ein Korsett gewesen, nie ein Angriff auf meine persönliche Freiheit – viel eher sind sie der Grund dafür überhaupt in die Situation zu kommen, mich frei entscheiden zu können. Denn ich kann weder entspannen, noch ruhen, noch Kraft tanken, wenn ich nicht weiß, was in den folgenden Stunden und Tagen noch auf mich zukommt und wie ich was wann wie genau kompensieren kann und darf.
Im günstigsten Fall mag ich die Art der Störungen des üblichen Ablaufs einfach nicht oder bin nur irritiert. Dann finde ich Stabilität und Ruhe in Stimming oder meinen Projekten. Problematisch wird es, wenn ich mit den Ressourcen schon so weit runter bin, dass ich weder von Stimming noch von irgendetwas anderem profitiere. Am schlimmsten ist es, wenn der Ablauf über so lange Zeit gestört oder beeinflusst wird, dass ich überhaupt keinen üblichen Ablauf mehr ausmachen kann.
Das gesamte letzte halbe Jahr war so ein Zeitraum. Wir haben viel gearbeitet, viele emotionale Tiefschläge kompensiert, die unsere Freund_innnenschaften bzw. das, was wir dafür hielten, betrafen. Wir haben Physiotherapie und Fahrschulunterricht in Theorie und Praxis durchgezogen, sind alle zwei Wochen nach Bielefeld zur Therapie und alle zwei Wochen zur Autismustherapie woanders gefahren. Wir haben uns an eine Selbsthilfegruppe für Viele herangewagt, haben einige erste Interviews für unsere Podcast-Reihe aufgenommen und alles das immer mit dem Partner und den Beziehungsalltag im Hinterkopf, die Bedürfnisse der Hunde, die Pflicht, die Kür, die Versprechen bezüglich des Gartens, des Podcasts, unserer Projekte.
In den letzten drei Wochen hatte ich jeden Tag einen anstrengenden Termin, seit Ende Oktober habe ich wieder mit Weglaufimpulsen aus Flashbacks/Alpträumen/Intrusionen aus dem Schlaf heraus zu kämpfen, was bedeutet, dass nicht einmal die Nachtstunden zuverlässig für Erholung da waren.
Dass ich noch nicht „ausgerastet bin“ (den Meltdown nach außen sichtbar hatte) liegt daran, dass ich eine Verzögerung in der Verarbeitung habe und in der Regel nach innen explodiere, also dissoziiere. Und weil die Dissoziation praktisch mein Betriebssystem ist – mich bisher niemand anders erlebt hat – fällt das nicht als Problem auf.
Manchmal finde ich das auch gut so. Denn mit der Ratlosigkeit, der Frage: „Ja und jetzt?“ umzugehen tut mir nur weh und oft ist es den Streit aus der Enttäuschung heraus, dass dieser Schmerz nicht bemerkt wird, einfach nicht wert.
Viele Menschen denken und planen nicht so weit im Voraus wie wir, weil sie es nicht müssen. Ihr Jetzt ist ein anderes als meins – ist nicht so leicht zu zerstören von morgen, bald oder nachher. Und viele Menschen schieben einfach gern auf, weil sie die Kraft für alles auf einmal aus einem viel tieferen, größeren Fass schöpfen als ich. Um in dem Bild zu bleiben, habe ich genau eine Tasse, aus der ich schöpfen kann und ich bin maximal geizig mit jedem noch so kleinen Tropfen, weil ich es muss. Nicht, weil es so schlimm ist, erschöpft zu sein, sondern weil „eine volle Tasse“ zu haben für mich a) nicht bedeutet, nicht erschöpft zu sein und b) weil auch das Management dieses Budgets, die Erfassung, die Planung, die Kommunikation des Budgets bereits daraus geschöpft wird.
Ich habe nie einen fixen Stand von 100 % und daraus kann ich dann hippy happy Leben gestalten – ich muss bereits 40 % weggeben, um in der Lage zu sein, mein hippy happy Leben erfassen, mich selbst darin fühlen und verstehen zu können. Und das ist, was die meisten Menschen – auch „meine Menschen“ – manchmal einfach vergessen: Die meisten Menschen müssen aus ihrem größeren Kraftfass vielleicht 10 oder 15 % dafür weggeben und das oft nicht einmal bewusst. Und am Ende eines Tages haben sie immer noch 20 bis 30 %, um zu verarbeiten, was sie erlebt haben. [1]
Ich habe nicht die Wahl irgendetwas von meinen Therapien (und dem, was wir darin machen) oder Projekten einfach zu lassen, denn ich benutze vieles davon zum Prozessieren und Verarbeiten sowohl dessen, was mir in der letzten Woche, aber auch vor 30 Jahren passiert ist. Jede Therapie, aber auch das Bloggen und Podcasten sind damit Hilfsmittel, die mir – bei aller Anstrengung, die sie bedeuten – ermöglichen, mich im Bezug zur Welt zu halten und damit ein fundamental wichtiger Teil eines mehr oder weniger festen Plans, der mich in diesem selbstbestimmten, autonomen Leben hält.
So einen Plan zu haben – ja, mir überhaupt erstmal einen zu überlegen, mich zu trauen an die Zukunft zu denken, mir eine auszudenken, zu wünschen, mich auf so viel hätte würde wäre wenn einzulassen, habe ich erst mit der Berufsausbildung geschafft. Das war 2016. Da waren wir gerade 9 Jahre aus organisierten Gewaltkontexten ausgestiegen, die uns sehr genau vorgegeben haben, was wann wie zu denken, zu wollen, zu machen war.
So frei wie heute verliert mein Leben und das, was ich darin tue, sofort an Bezug und damit Sinn und Bedeutung, wenn ich meinen Plan loslassen soll. Und das wird bewusst oder unbewusst öfter mal von mir verlangt oder „vorsichtig vorgeschlagen“, wenn der Eindruck entsteht, ich hätte mich verrannt oder überfordert. Oder – was eigentlich am meisten schmerzt – : Wenn ich selber sage, dass etwas zu schwierig für mich ist.
Der erste Reflex ist dann oft die Idee der Entlastung durch Vermeidung. Das Angebot mir irgendeine Aufgabe abzunehmen, irgendein Wagnis nicht zu begehen und zu erwarten, dass ich das okay finde – vielleicht sogar noch krass dankbar bin und mich einfach super fühle. Das tue ich in der Regel aber nicht, denn die Alternative zur Überforderung ist in meinem Fall immer der Ausschluss. Das nicht mitmachen, nicht dabei sein, ohne Bezug sein. Ein Zustand, den so, in dem Umfang wie ich es erlebe, kaum jemand wirklich innig er_leben möchte, weil Bezug für soziale Wesen wie uns Menschen ein existenzielles Grundbedürfnis ist. [2]
Wie viele andere autistische Menschen bin ich sehr hartnäckig. Was ich mir vornehme, das mache ich früher oder später auch. Ich nehme mir nichts vor, das unrealistisch ist und verfolge meinen Lebensplan jeden Tag, weil ich einen brauche, um mein Amlebensein in Existenz und Sinn auszuhalten und zu gestalten.
Das ist nicht banal. Nicht wegzulachen oder zum Quirk zu erklären.
Es ist bedingungslos zu respektieren und mitzudenken.
Immer.
[1] In diesem Text verwende ich das Bild von einem Fass bzw. einer Tasse voll Kraft als Flüssigkeit. Viele andere chronisch kranke, neurodiverse, behinderte Menschen verwenden das Bild von einem bestimmten Budget von Werkzeugen/Besteck, das sie zur Verfügung haben. In der Podcastepisode „Was helfen könnte – die Besteck-Theorien, eine Kommunikationshilfe“ habe ich sie genauer beschrieben.
[2] Angebote wie diese führen viele behinderte Menschen in die sogenannte „Schonraumfalle“, was dazu führt, dass Abhängigkeiten entstehen und also die Freiheit der Menschen eingeschränkt wird. Sowohl die der behinderten Menschen als auch die der Menschen, die ihnen die Schonräume ermöglichen und aufrechterhalten müssen.
Mir ist bei Überforderung am besten zu helfen, wenn man mich dabei unterstützt, den Punkt der Überforderung zu verstehen und mit dem auszustatten (oder mir zu ermöglichen, dass ich lerne), was ich brauche, um sie zu überwinden.
Jede Hilfe, die Helfende überflüssig macht, ist besser als der beste Schonraum.


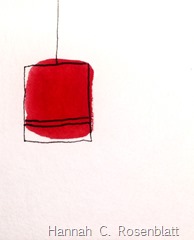 und dann öffnet sie die Tür und die Dezemberkälte rieselt von ihren Kleidern auf die Schmutzfangmatte.
und dann öffnet sie die Tür und die Dezemberkälte rieselt von ihren Kleidern auf die Schmutzfangmatte.