Erst dachte ich, das wäre die erste richtige Körperkrankheit in diesem Jahr, doch das stimmt nicht. Anfang des Jahres lag ich mit einem Infekt flach. Wobei – wirklich flach lag ich da auch nicht. Damals (oh G’tt ja damals, im Januar? Februar?) als mir der Weg ins Jahr 2014 so klar erschien: Buch fertig kriegen, Nachwachshaus anleiern, Geld verdienen, Dinge bewegen, BOOOYAAAH- es würde hart, aber es würde zu schaffen sein, weil – wieso denn nicht?! , lag ich nicht im Bett, sondern machte noch ein Irgend-wie-Interview für das Buch und zeichnete im Bett Skizzen von Hausgrundrissen und versuchte mich auf Texte zu konzentrieren, die sich darum drehten, was gute Literaturagent_Innen ausmacht.
Und jetzt ist Dezember.
Es ist Tag 2 des Pendelns zwischen 38° und 39° C und der erste ohne „Guten-Morgen-Magensäure aus der Tupperdose neben dem Bett spülen“.
Ich habe mein Buch nicht fertig. Will es sogar nochmal neu schreiben. Ich liege im Bett und döse, träume von einer Hütte im Irgendwo mit Stille im nächsten Umkreis. 3 Wochen nichts weiter tun als schlafen, essen und schreiben. Hach.
Ich schlafe fast, da rollt an, was anrollen muss, wenn jeder Muskel und Knochen im Körper schmerzt: Erinnern.
Ich bilde mir ein, ich könnte mein Erinnern gut vermeiden, gut wegschieben, gut in kleine Kisten und Umschläge stecken, die verstreut geparkt werden können. Jetzt spüre ich, wie viel tatsächliche Muskelkraft es erfordert und wie wenig davon in mir ist, wenn ich krank bin. Ich kann nichts wegdrücken, nur selbst vergehen und als Geist über mir schweben.
Es sind Träume, die ich da sehe. Ganz sicher, denn niemand würde so etwas jemandem antun. Ganz sicher sind es Träume oder Fieberhalluzinationen.
Aufwachen, erbrechen, weinen, frieren, NakNak*s Zunge an der Hand, die mich vom Boden abstützt spüren. Atmen, warten, Krankheit realisieren. #Mimimi
Aufstehen spülen, waschen, dem Piepen der Mikrowelle zuvorkommen und die Wärmestofftiere befreien.
Die Warmies sind großartig. Sie sind sehr weiche Plüschtiere mit Hirse und Lavendel drin. Wir haben eine Eule und eine Robbe vom Weihnachtsmarkt. Die Robbe haben wir am Donnerstag gekauft. Nach der Therapiestunde, die so furchtbar war, weil uns niemand angebrüllt hat.
Manchmal ist es einfach so, dass alles besser wäre, wenn Menschen uns nur anbrüllen und herumschubsen würden. Wegschubsen und einsperren und wenn die Tür wieder aufgeht ist alles auf Anfang. Vom Point of no return auf reset und los. Neues Spiel neues Glück.
Gewonnen haben wir nie, aber wer weiß? Beim nächsten Mal…?
In dieser Lavendelwolke herumschweben ist schön. Eine Schmerztablette, eine halbe Tasse Tee. Erst zu heiß zum trinken, dann eiskalt aufklirrend im Magen, obwohl doch nur ein Wimpernschlag vergangen ist.
 NakNak* schläft mit. Drückt ihren Rücken an die warme Robbe auf meinem Bauch und ich darf meine Hand auf ihrer Seite liegen lassen.
NakNak* schläft mit. Drückt ihren Rücken an die warme Robbe auf meinem Bauch und ich darf meine Hand auf ihrer Seite liegen lassen.
Peter Härtling liest uns die Geschichte von den Scheurers vor und draußen regwindet es.
Meine Beine werden aus den Hüftgelenken gerissen und Blut sickert langsam aus dem Inmitten von mir. Ich sehe mich schreien und zerfallen, und fühle das dichte Fell meiner ruhig atmenden Hündin direkt vor mir. Es legen sich weiche weiße Federn auf meinen Kopf und alles wird dicht und dichter und schwammiger und als ich aufwache tapst NakNak* an meine Schulter. Kratzt mich sachte.
17.58 Uhr
Abendbrot um 18 Uhr- Verspätungen werden hingenommen, doch nicht kommentarlos.
Ob ich ihr Futter aus dem Plastik drücke oder mein eigenes Fleisch kann ich nicht trennen. “Guten Appetit liebste Mopsmaus”, sage ich “bitte nicht”, schreit es dumpf irgendwo da ganz irgendwo dort, wo man nichts mehr erkennt.
Ich mag Kartoffelbrei. Er erinnert mich an Kranksein mit Bibi Blocksbergkassetten und der ersten Gemögten.
Jetzt koche ich Kartoffeln zu Tode und zerdrücke sie zu Kartoffelbrockenmatsch.
Meine erste Gemögte hat mich verlassen dieses Jahr. Ich will nicht mehr dran denken, aber tue es dann doch. 2014, ein Jahr voll Trennungschmerz und ich hasse mich, weil ich keines meiner Projekte beendet bekomme. Wir sitzen in der Küche und zittern uns die Muskeln wund. “Siehst- Mögen tut weh. Einfach lassen in Zukunft.”
Schwaches Nicken. Okay. Mir egal. Alles egal.
Der Kartoffelbrei ist zu salzig. Er brennt bei seiner Wiederkehr.
#Magenmimimi und #Bauchbubu baden in Magenbalance Kräutertee und ich hänge über dem Waschbecken und schaue meiner Nase beim Bluten zu.
Ich frage mich, ob sie mich anschauen könnte. Sie hatte uns gesehen begraben unter Rettungssanitätern auf ihrer Couch. Geschüttelt von Krampfanfällen, kotzend wegen Narkotika, die kaum halfen. Heulend im Wunsch nach Kontakt zu Menschen, die uns misshandelten. Da sind so viele Tiefen gewesen, die sie gesehen hat.
Und 7 Jahre später reicht es nicht einmal zu einem Anruf.
Blutblüten im Waschbecken. Tropfkunst mit Ende.
Wieder ins Bett. Ich nehme mir vor, die Matratze zu drehen. Ich fühle schon wieder den Lattenrost durch den Schaumstoff. Aber jetzt bleibe ich liegen.
Ich traue mir kein Feuermanagment zu. Weine ein bisschen, weil Chanukkah mein liebstes Fest ist. Weil ich an diesem Wochenende eigentlich meine Familie° besuchen wollte.
Nun liege ich im Bett und sehe mir beim Sterben zu, während ich mich über meinen Pathos auslache.
Morgen wirds vorbei sein. Das ist nur ein Virus. Nur ein Magen-Darm-irgendwas Virus und ich sollte nicht denken, nicht fühlen, das stört nur den Prozess.
Und ruckartig lösen sich meine Oberarme aus den Schultern. Es knirscht im oberen Rücken und jede weitere Bewegung wäre jetzt das Ende.
Ich denke nicht, ich fühle nicht. Das stört nur den Prozess, der mir gemacht wird.
Und als ich aufstehe, bin ich tot. Alles ist taub außer der Schmerz im Nacken- und im Lendenwirbelbereich. Kein Erbrechen, kein Fieber mehr.
Nur dumpf drückende Masse hinter dem Gesicht. Schwindelgefühle. Zittern, das nicht aufhört. Wimmern und ein Schrei im Kopf.
Da sind Muskeln, die sich gegen das Erinnern stemmen und glühend heiß gelaufen durch die Haut brennen. Alles nur ein Traum. Erinnern an Fieberhalluzinationen.
Ich sitze vor dem Bett und streichle über ihren verschwitzen Kopf.
Ziehe die Decke noch ein bisschen höher.
Lege Federn über sie.
Es ist Sonntag, der 21. Dezember 2014
die Rosenblätter kranken
Gut, dass ich keins von ihnen bin.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
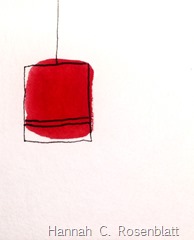 und dann öffnet sie die Tür und die Dezemberkälte rieselt von ihren Kleidern auf die Schmutzfangmatte.
und dann öffnet sie die Tür und die Dezemberkälte rieselt von ihren Kleidern auf die Schmutzfangmatte. NakNak* schläft mit. Drückt ihren Rücken an die warme Robbe auf meinem Bauch und ich darf meine Hand auf ihrer Seite liegen lassen.
NakNak* schläft mit. Drückt ihren Rücken an die warme Robbe auf meinem Bauch und ich darf meine Hand auf ihrer Seite liegen lassen.