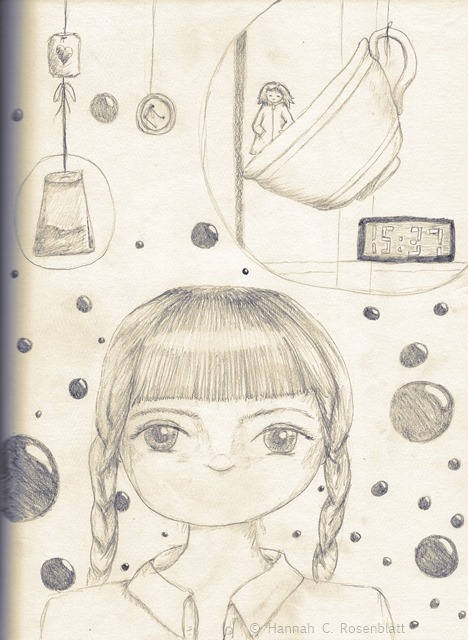Vor ein paar Jahren haben wir einen Text veröffentlicht, in dem wir begründen, weshalb wir unsere Gewalterfahrungen nicht als “sexuellen Missbrauch” bezeichnen und auch nicht von anderen Menschen, dem Gesetz oder Institutionen so bezeichnen lassen wollen.
Inzwischen haben wir Betroffene kennenlernen dürfen, die um den Begriff “sexueller Missbrauch” für die eigenen Erfahrungen kämpfen und einige Gedanken dazu möchte ich hier nun teilen.
Ich beginne damit, dass nachwievor immer und überall Raum für die eigenen Worte zu eigenem Erleben sein muss und soll.
Egal worum es geht, muss es erlaubt sein zu sagen, was auch immer man wie sagen will. Und ja, für uns schließt das auch Begriffe ein, die auch eine rassistische, ableistische, sexistische oder anders *istische Konnotation mit sich bringen. Denn diese eigens für das eigene Empfinden passend empfunden Begriff spiegeln nicht nur die Person und ihr eigenes Wertesystem und Weltbild, sondern auch das des Umfeldes (oder der Umfelder), in dem man lebt(e) und aufgewachsen ist.
Solchen Begriffen Raum zu lassen bedeutet noch keinerlei Legitimation oder Zustimmung.
Ihnen keinen Raum lassen bedeutet jedoch Menschen stumm zu machen, die noch keine anderen Worte oder Identifikationszugänge gefunden haben und damit einen Ausschluss zu praktizieren, der mit dem Wunsch nach einem Miteinander, an dem man in sowohl Worten als auch Taten gemeinsam arbeitet, nicht vereinbar ist.
Was hier ein bloßer langer Satz ist, ist in der Realität schmerzhafter Prozess, zähes Ringen, sozialer Kampf um Be.Deutungshoheit und Ressourcen, der von Privilegien, struktureller und individueller Sicherheit und Machtausübung geprägt ist.
Es bedeutet, dass sich Nazis in die Innenstadt stellen und ihre entmenschlichenden Parolen grölen dürfen. Es bedeutet, dass Abtreibungsgegner einen 8 Tage alten Zellklumpen “Kind” nennen. Es bedeutet, dass manche Menschen “sexueller Missbrauch” sagen, wo andere von “sexualisierter Gewalt” sprechen.
Hauptsache man redet drüber?
Manchmal frage ich mich das. Obwohl ich den Unterschied zwischen Wortproduktion und Gesprächen, durch die etwas wächst und Prozesse angestoßen werden, in diesem unseren Informationszeitalter auch sehr klar vor Augen habe.
Heute wird sehr viel geredet. Heute wird zuweilen fast erwartet alles, aber auch wirklich alles, auszusprechen. Wo eine Grenze auftaucht, und sei es eine aus Scham motivierte, da soll es drüber gehen. Schließlich leben wir so frei, dass uns auszudrücken keine Grenzen mehr kennen darf.
Aber nicht jedes Gespräch hat Wert. Nicht jedes Aussprechen schwieriger Dinge hat Konsistenz oder ist etwas Neues, obwohl man selbst vielleicht den Puls im Hals gefühlt hat beim Reden. Besonders wenn wir uns selbst ausdrücken – also wir Rosenblätter uns – dann hilft es uns, uns daran zu erinnern. Alles was wir sagen, gibt es und hat es schon gegeben, bevor wir es aus Luft und Zungenbewegung geformt haben. Oder aus den kleinen Blitzen in unserem Gehirn gezaubert haben.
Eine Bedeutung und eine Identifikation mit dem Gesagten können wir jedoch erst dann entwickeln, wenn es gesagt ist. Auch dann, wenn das, was wir da sagen für andere Menschen problematisch, langweilig, wirr, unverständlich ist.
Die Frage ist an der Stelle nicht, wer was sagen darf oder soll, damit sich alle miteinander wohl fühlen – die Frage ist, wie man sich miteinander wohlfühlt, während man zueinander spricht. Worin muss man sich einigen, welchen Grad des Dissens kann man mit wem ertragen, tolerieren, aushalten? Welche Grundvoraussetzungen müssen zuvorderst erfüllt sein, um überhaupt zu überlegen, welche Art des Dissens man miteinander toleriert?
Ich weiß jetzt schon, dass ich mit einem Nazi niemals über Migrationspolitik sprechen würde – aber ganz sicher würde ich mit ihm sprechen, wenn sie_r blutend unter einem Laster im Sterben liegt.So gehen wir heute in Gespräche mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie wir gemacht haben, sie aber anders benennen. Wir fragen uns: Was ist uns wichtig? und Mit wem sprechen wir?
Wir nennen es “von Täter_innen sexualisierte Gewalt”, weil uns folgende Dinge beim Sprechen darüber wichtig sind:
– nichts an der Gewalt hatte mit Sexualität zu tun, denn Sexualität ist konsensuell und Gewalt ist es nie
– die Personen, welche die Gewalt an uns sexualisieren, sind die Täter_innen – auch die Mittäter_innen und auch die Personen, die sich durch eine Sexualisierung der Gewalt im Nachhinein (oft ungewollt und unwissentlich) zu Mit.täter_innen werden
– es geht um Gewalt – es ging immer um Gewalt und das zu Erkennen (zu identifizieren) und immer wieder mitzukommunizieren, geht für uns nur mit dieser Benennung
Von Betroffenen/Erfahrungsexpert_innen/früheren Opfern/* , die den Begriff des “sexuellen Missbrauchs” für sich passend empfinden, haben wir erfahren, dass ihnen andere Dinge wichtig sind.
Sie sagen so etwas wie “Ich wurde benutzt wie ein Gegenstand.”, “Ich wurde in der Situation entmenschlicht (denn es hat meine Sexualität oder mein Verständnis davon angefasst und ich halte Sexualität für ein Merkmal, das Menschen entscheidend ausmacht)” oder “Von Missbrauch haben alle schon gehört – ich will nicht immer erst klären müssen, was ich mit “sexualisierte Gewalt” meine (dafür habe ich keine Kraft/dazu hab ich keine Lust/das lenkt ab von dem, was ich mit.teilen will)”.
Wenn wir einander als Erfahrungsexpert_innen begegnen, wir also bereits voneinander wissen, dass wir sehr ähnliche Erfahrungen teilen, dann ist uns das genug gemeinsame Basis für die Toleranz der eigenen Begrifflichkeiten. Wir wissen: Wir reden über Persönliches. Wir sind einander offen und nah, haben gerade vielleicht sogar andere Schutzschilde oben, als Menschen gegenüber, die nicht diese Erfahrungen machen mussten. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind wir beide froh überhaupt gerade reden zu können und eben nicht stumm zu sein, weil wir nicht wissen, was wir wie und wie viel wovon sagen können, ohne ausgeschlossen zu werden. Und sei es durch das bodenlose Schweigen derer, die weder hören wollen noch können, weil sie (noch) keine Umgänge gefunden haben.
Anders sehen wir es in politischen Kontexten. In den Nachrichten, in Reportagen und Dokus, in denen Erfahrungsexpert_innen wie wir gleichzeitig ein tragischer Einzelfall und eine homogene Gruppe sein sollen, ohne, dass dem angemessen Rechnung getragen wird. Auch bei Öffentlichkeitsarbeit sehen wir das anders.
Da fällt es uns enorm schwer damit zu leben, wenn überall von Missbrauch gesprochen wird. Schlimmer noch in einer Form, welche die Gewalt als solche weder benennt noch durch Umschreibungen aufzeigt. In dem Moment fühlen wir uns missbraucht und erleben das als etwas, das sehr schlimm ist. Weil dieser Empfindung Ausdruck zu verleihen auch bedeutet zu stören, zu belasten und anderen Menschen, für die es wichtig, richtig und gut ist, wenn das so passiert, die Plattform für die eigene Botschaft anzugreifen.
Obwohl heute anders und vielleicht sogar mehr darüber gesprochen wird, wird nachwievor nicht immer gut und genug darüber gesprochen.
Jede Gelegenheit ist gut und wichtig das Thema der Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun, anzubringen. Einfach, weil sie zerstört, verstümmelt, verdreht, tötet. Weil sie nicht richtig ist. Weil sie passiert. Jeden Tag.
Jeden. Jeden. Jeden. Tag.
Überall.
Und weil das so ist, ist es wichtig sich damit auseinanderzusetzen, wie man es gut machen kann.
Was “gut” in Bezug auf Berichterstattung und Aktionswording überhaupt meint. Gut für wen? Gut für wann? Gut aufgrund welcher Wirkung?
Und kann “gut” nicht auch bedeuten “gut genug, um konstruktiv damit zu arbeiten”?
Als Aktivist_in stellen sich für uns Fragen nach Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Aktivismus.
Wir wissen, dass es uns nachwievor stört, dass es im Gesetz heißt “sexueller Kindesmissbrauch” und eben dieses Gesetz auch noch ein sogenanntes “Sexualstrafgesetz” ist. Als würde mit einem Urteil eine rein von Sexualität gesteuerte Handlung bestraft und sei genau das kein Widerspruch zu dem, wie man Sexualität heute sieht, erforscht hat und auch lebt.
Wir wissen aber auch: Wie das Gesetz heißt, was die Justiz in der Sache macht, hatte nie und wird nie für uns irgendeine Rolle bei der eigenen Verarbeitung spielen. Wir brauchen keine_n Richter_in, die_r unsere Erfahrungen als solche anerkennt.
Wir brauchen ein soziales Umfeld, das es tut. Und deshalb setzen wir dort an.
Wir umgeben uns mit Menschen, deren Sprache wir gut genug tolerieren können. Sprechen selbst so, wie es für uns gut passt, machen Kompromisse, ändern unser Wording und sagen vielleicht sogar manchmal Dinge, die an anderen Stellen problematisch sind, wenn sie helfen, einander auf der subjektiven Ebene verständlich zu machen.
Manchmal, weil es nötig ist und inzwischen immer öfter auch, weil wir es können.
Wir haben nicht mehr so stark das Gefühl uns selbst zu verlieren oder nicht mehr authentisch zu sein, wenn wir verschiedene Begrifflichkeiten für unsere Erfahrungen zulassen. Oder, wenn andere Menschen aussprechen, was wir erfahren haben. Je mehr wir unsere Erfahrungen verarbeiten, desto stabiler ist auch das Spüren der so grauenhaft banalen Alltäglichkeit der Gewalt und der Beliebigkeit ihrer Opfer.
So funktioniert das bei uns. Wir merken: Wir sind nicht allein, waren es nie und werden es nie sein. Ob wir wollen oder nicht – die Wörter für die Erfahrung müssen wir miteinander teilen, obwohl die Erfahrung selbst ganz allein zu uns gehört.
Auf unseren Teebeutelzettel stand heute drauf, Erfahrung sei das Einzige, was man wirklich besitzt. Vielleicht ist da was dran. Denn so furchtbar es für uns ist, die Erfahrungen gemacht zu haben, so schlimm wäre es für uns, sie an irgendjemand anderes abzugeben.
Doch mit dem, was man besitzt kann man machen was man möchte. Man kann sie so benennen, wie man es gut und richtig findet, man kann ihnen den Raum geben, den man für sie braucht, wünscht, will. Man kann sie für sich nutzen, man kann sie unbeachtet lassen.
Doch eins kann man mit Gewalterfahrungen einfach nicht machen: verleugnen, dass sie auch mit anderen Menschen zu tun haben. Dass sie sowohl eine menschheitlich kollektive Erfahrung sind, als auch durch andere Menschen an einem_einer selbst passiert sind.
So ist das Ende dieses Textes eins, das Anerkennung individueller Umgänge wachsen lassen möchte, statt wie damals noch die Notwendigkeit von Einheit auf allen Ebenen zu fordern, als wäre nur so eine Veränderung möglich.