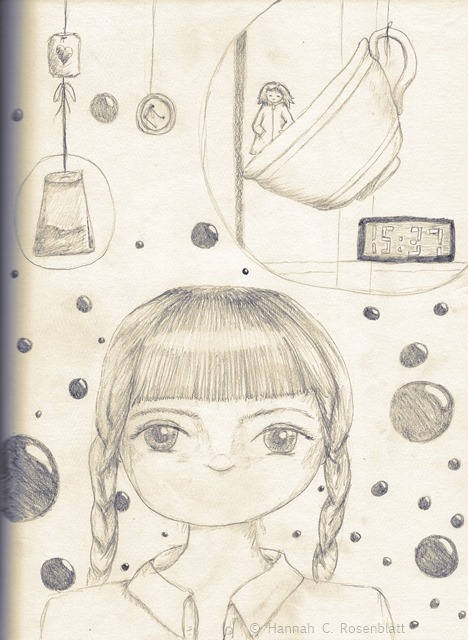Vor dem Termin hatte ich Angst. Termine, die mit dem Gericht zu tun haben, machen mir immer Angst.
Nicht, weil ich fürchte, man würde mich für irgendetwas ins Gefängnis sperren oder mich bestrafen, sondern, weil ich weiß, dass wir dem, was dort passiert, nie gewachsen sind.
Wir haben das Problem, das viele Viele und viele autistische Menschen haben: man sieht uns nicht an, was in uns vorgeht.
Entweder macht mein Gesicht etwas, das von anderen Menschen nicht korrekt übersetzt werden kann oder es macht gar nichts, weil all meine Kraft in das Erfassen der Vorgänge um mich herum geht und nichts mehr übrig bleibt für Körpersprache.
Wir haben das Problem, das viele Menschen, die (lange) in sogenannten “Hilfe”systemen leben, weil wir es brauchen: wir sind abhängig von jenen, die strukturell oder persönlich als unsere Helfer_innen auftreten bzw. bestellt werden – was bedeutet, dass wir unfrei sind und nur so befähigt zur Befähigung sein können, wie sie (und die gegebenen Strukturen) uns dazu ermächtigen bzw. befähigen.
Und wir haben das Problem, dass wir uns all dessen bewusst sind. Während viele andere es nicht sind und auch nicht sein wollen.
Ich hatte vor dem Termin Angst, weil ich Angst vor unserer gesetzlichen Betreuerin habe. Vor ihrer Ignoranz mit der sie mit der Macht, die wir ihr übertragen haben, umgeht. Vor ihrer falschen Überzeugung, die sich durch keine unserer Richtigstellungen und Erklärungen korrigieren lässt.
Wir rutschen nachwievor selbst immer wieder in die Todesangst, von der wir Pädagog_innen und anderen Betreuer_innen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, erzählen. Wir selbst erleben uns immer wieder in der Überzeugung, dass, wenn dieser eine Zettel falsch ausgefüllt wird – dieser eine Beschluss falsch ist – dieses eine Gutachten unzutreffend ist – dieser eine Bericht strunzfalsche Aussagen enthält – dieser eine Antrag inkorrekt ausgefüllt wird – wir sterben werden (weil wir etwas falsch gemacht haben/niemand uns helfen wird/wir allein und ausgeliefert (bleiben) werden/weil wir unter- oder gar nicht versorgt werden/weil das doch jede_r kann und es unsere Strafe ist, zB etwas Beantragtes nicht zu bekommen, damit wir es beim nächsten Mal gefälligst richtig machen…)
Das ist kein überkandideltes Einbildungsängstlein, das man im Fall des Falls auch durch eine Kognition auflösen kann. Das ist eine Angst, die uns den Hals zupulst und den gesamten Organismus mit toxischem Stress flutet. Das ist Traumawiedererleben. Das ist, was man, wenn man so will, “PTBS-Dünger” und “Traumatherapiegift” nennen könnte.
So ein Stresslevel verändert die Denkstruktur, verändert die rein neurologisch verfügbaren Möglichkeiten, um Inhalte zu erfassen und zu verarbeiten und verändert natürlich auch die Ressourcen der sozialen Interaktion und verbalen wie nonverbalen Kommunikation.
Zusammen mit unseren allgemeinen Schwierigkeiten andere Menschen zu lesen und ihre Handlungen und Aussagen zu verstehen, sind wir folglich bei allen Gesprächen mit solchen Schwerpunkten massiv gehandicapt.
Und ich schreibe hier bewusst “gehandicapt”, denn behindert werden wir an der Stelle ganz klar von der Ignoranz der Menschen, mit denen wir es dann zu tun haben und von den Strukturen, die diese Ignoranz erlauben.
Vor dem Termin hatte ich noch getwittert, dass ich mir NakNak* an unserer Seite bei dem Gespräch gewünscht hätte. Zum Einen, weil wir uns im Innen grundlegend anders aufstellen können, wenn wir nicht nur für uns, sondern auch sie sorgen müssen und sie uns frühzeitig einen Krampfanfall meldet – zum Anderen aber auch, weil sie durch ihre Anwesenheit als Assistenzhund greifbarer macht, dass wir eine behinderte Person sind. Dass wir “wirklich etwas haben” und nicht nur so tun oder es eine Frage der individuellen Einschätzung von Außen ist, ob da etwas ist oder nicht und wenn doch, wie sehr.
Doch bei Gericht herrscht kategorisches Hundeverbot. Natürlich könnten wir uns um einen medizinischen Zettel bemühen auf dem steht, dass wir echt was haben und der Hund in echt hilft, besser klar zu kommen – aber natürlich müssten wir dazu mal wieder eine_ Mediziner_in beanspruchen, unsere Zeit für andere Dinge abknipsen, unseren Fokus erneut nicht auf uns und das was wir brauchen legen, sondern darauf, was andere (ablierte) Menschen brauchen, damit sie etwas tun dürfen, damit wir bekommen, was wir brauchen.
Der Satz ist jetzt recht lang – man darf ihn sich trotzdem mal tief in den Kopf tun und dann einen Blick auf die Behindertenrechtskonvention werfen, bitte danke.
Ich wünsche mir mehr Bewusstsein um diesen Umstand bei anderen Menschen. Ich wünsche mir mehr Bewusstsein darum, dass Behinderungen der Wahrnehmungs_Verarbeitung existieren und ganz konkrete Folgen für das Miteinander haben.
Wir haben massive Probleme in Gesprächstermine zu gehen, ohne zu wissen worum genau es konkret gehen wird. Was von dem, was wir sagen wollen und wichtig finden, gehört überhaupt in diesen Termin? Was genau sollen wir leisten? Müssen wir große Entscheidungen treffen – und wenn ja – was sind die Kriterien, an denen wir uns dazu orientieren sollten/können/müssen?
Diese Probleme haben wir nicht erst seit gestern. Die haben wir schon seit immer – doch existenziell problematisch wurden sie erst, seit wir mit 15 zum ersten Mal vor einer Jugendamtssachbearbeiterin gesessen haben und ohne die Tragweite unserer Aussage überhaupt selbst umfassend verstehen und überblicken zu können, unserer Fremdunterbringung zustimmten.
Unser Gerichtstermin gestern, war die Folge unseres Anrufs dort, nachdem unsere Betreuerin auf unseren Zusammenbruch über das Ende unserer Sicherheit sagte, sie wüsste wie es uns jetzt ginge und anderen grenzüberschreitenden Bockkackscheißmist von sich gab, der uns in massive Zweifel brachte, ob sie überhaupt je verstanden hat, was wir ihr über unsere Geschichte, Trauma und Autismus als unsere zentralen Probleme gesagt hatten.
Was wir nicht wussten war, dass, wenn man in so einem Fall bei Gericht anruft und fragt, ob es Klärungsoptionen gibt, die man nutzen könnte, um weiterhin gut miteinander zu arbeiten, das automatisch als Beschwerde gilt und damit einen Betreuerwechsel einleitet.
Der Richter beantwortete unsere Unkenntnis dessen lapidar mit “Ja, manchmal sind Wissensdefizite hinderlich.”
Dass meine Erziehung und Therapie schon länger passiert war, fand ich in dem Moment auch hinderlich.
Denn statt ihn zu hauen oder anzuschreien, wie ich es gerne getan hätte, bekam ich den ersten Krampf im rechten Arm, Schreie im Kopf und einen Hyperarousel aus der Hölle. Spätestens jetzt hätte NakNak* angefangen zu bellen und mich zu kratzen. Und alle Anwesenden hätten gemerkt, dass jetzt Stopp ist.
Dass jetzt schon der Moment ist, in dem nichts mehr geht. Weder lieb-Performance, noch brav-Tänzchen, noch konstruktiver Beitrag zum Thema.
Aber NakNak* war nicht da. Und ich habe es nicht gemerkt.
Ich dachte, ich müsste retten, was zu retten ist. Zusammenreißen, stark sein, nicht einknicken, dran bleiben, für mein Recht auf eine gesetzliche Vertretung, die angemessen ist, kämpfen, mich darum bemühen, verstanden zu werden, nicht aufgeben selbst zu verstehen – obwohl niemand merkt, dass ich nicht verstehe.
Ich traf eine Entscheidung von der ich nicht weiß, ob sie richtig war und auf Wegen, die sich mir nicht erschlossen, da ich noch längst nicht fertig war mit dem, was ich zu sagen hatte, war das Gespräch dennoch einfach plötzlich zu Ende.
Wir gingen raus auf den Flur, die Betreuerin wollte “schnell noch was mit uns besprechen” und ich hatte das Gefühl jeden Moment einen Schrei aus mir herauszukotzen, dessen Ursprung, Sinn und Ziel mir fremd war.
Für mich waren Zeit und Raum schon längst zerbrochen und lose an seinen Fäden aus dem Universum herunterbaumelnd, wie ein Sitz im Kettenkarussell. Und wenn man mich fragt, dann ist es genau das, wovor wir Angst haben, wenn wir Angst vor Kontrollverlusten haben.
Es ist Trauma 101.
Traumatische Erfahrungen sind deshalb traumatisch, weil das Gefühl für den Kontext (und sich selbst darin) verloren geht. Verstärkt wird es durch körperliche Versehrungen oder emotionale Not. Manchmal geht es auch darum, etwas zu erfahren, das niemand sonst erfährt bzw. das nicht alltäglich ist, was die Kontextualisierung erschwert.
Für uns hochtraumatisierte Person mit Problemen der Kommunikation und Interaktion, war dieser Termin von Anfang an einer, bei dem klar war, dass wir genau das (wieder)erleben werden. Und niemand hats gerafft. Niemand.
Ausnahmslos.
Wir wussten nichts vor diesem Termin über diesen Termin, außer, dass es um unsere Betreuungszukunft geht. Was alles bedeuten kann. Da wir noch keine gesetzliche Betreuung vor dieser hatten, haben wir noch nicht genug konkrete Erfahrungen auf die wir zurückgreifen konnten, um uns den Kontext zu erschließen.
Und da niemand verstanden hat, dass wir ein bisschen mehr brauchen als “kommen sie da mal hin, es ist ein wichtiger Termin”, haben wir auch nicht mehr bekommen – und natürlich auch nichts weiter gefordert.
Mehr Forderungen kosten mehr Kraft und davon haben wir seit einer Weile häufig gerade mal soviel, dass wir nicht vergessen zu essen, zu trinken, uns nicht das Leben zu nehmen.
Trotzdem lautet die Prämisse für alle und immer: Wenn sie was wollen/brauchen – fordern sie es ein.
Irrational sind sie. Solche Einladungen zu etwas, das in der Regel weder gemocht noch selbst gerne erfüllt wird.
Weshalb sie eben auch immer wieder an uns als Option herangetragen werden. “Soll sie halt was sagen, wenns ihr nicht passt – wer schweigt stimmt zu.”
Wer schweigt, weil zum Fordern keine Kraft da ist, hat in dieser Logik selbst schuld und damit die eigene Diskriminierung verursacht.
Muss ich jetzt noch einen Satz dazu schreiben wie unfassbar ignorant und abstoßend so eine Haltung ist?
“Keine Kraft” bedeutet in unserem Leben sowas wie: “Scheiße, ich hab mir die letzte saubere Hose vollgepisst, weil ich schon seit Stunden auf Küchenboden liege und nicht mehr hochkomme. Scheiße, ich muss Wäsche waschen. Scheiße, ich muss sie aufhängen. Scheiße, ich hab für morgen nur noch Klamotten, die zu groß sind, anzuziehen. Scheiße, ich hab so viel Gewicht verloren. Scheiße, ich muss mehr essen. Scheiße, hab ich heute überhaupt schon gegessen? Scheiße, hat der Hund gegessen? Scheiße, der Hund muss noch raus. Scheiße, ich bin so scheiße zu ihr. Scheiße, ich kann keinen Hundesitter engagieren. Scheiße, ich komme mit nichts hinterher. Scheiße, es ist so viel zu tun. Scheiße, ich bin so viel zu wenig vor all dem Viel.”, zu denken, währenddessen die Sonne untergehen zu sehen und zum x-ten Mal den Timer für irgendwas, was an diesem Tag zwingend dringend zu erledigen ist, zu bemerken.
Und. nicht. zu. können.
Nichts fordern zu können. Nichts sagen zu können. Und auch: nichts und niemanden um irgendetwas bitten zu können, weil irgendwann nicht einmal mehr klar ist, wo man überhaupt anfangen sollte. Was geht. Was man fordern könnte.
Was man mehr tun kann, als zu sagen: „Ich habe keine Kraft.“ oder „Ich kann nicht.“
Uns wird so lapidar hingerotzt, wir müssten einfach mehr Hilfe fordern, dass nicht gewertschätzt wird, wie viel es von uns abverlangt, wenn wir es tun. Wie viel Not dahinter ist, wenn wir das tun. Es wird übersehen, dass unsere Forderungen niemals und zu keinem Zeitpunkt so lapidar an andere Menschen herangetragen werden, wie es mit der Aufforderung dazu an uns passiert.
Man achtet zu wenig auf uns, wenn es um uns geht.
Und das ist uns gestern zum Verhängnis geworden.
Schon wieder.
Trotzdem wir mit dem Begleitermenschen da waren.
Die Betreuerin sagte etwas, ich stopfte mir den nächsten Schreiimpuls in den Hals und lief weg.
Ich erinnere mich daran, dass ich meine steinharte Hand mehrmals gegen Wandstücke schleuderte und daran, dass ich dem Begleitermensch etwas später sagte, dass ich deshalb ins Krankenhaus wollte. Tatsächlich hatte ich es ihm aber mit dem Talker vermittelt und auch danach noch einige Stunden nicht mit Lautsprache kommuniziert.
Wir hatten einen Krampfanfall, der übermäßig lange anhielt und waren auch lange danach nicht in der Lage zu re-interagieren.
Das Erste, was ich konsistent erinnere, ist die Wand des Krankenhausimmers, deren Oberfläche nach Kiwi schmeckte.
Ich erinnere Schwindel, Erschöpfung, den Wunsch nach Versorgung, die mir etwas von dem nimmt, worunter ich litt. Schmerzen, Scham, Selbsthass, Schuldgefühle, Wut, Ohnmacht, unerträgliche Mitgefühle für andere Menschen.
Nach einigen Stunden und zwei Röntgenaufnahmen des Arms, verließen der Begleitermensch und wir das Krankenhaus mit Schwindel, Erschöpfung, Schmerzen, Scham, Selbsthass, Wut, Ohnmacht und dem Gefühl, die eigene Not selbst verursacht zu haben.
Im Arztbrief steht der Begleitermensch als unser Betreuer.
Weil er weder Freund noch Passant war, wurde er eben der Betreuer für eine behinderte Frau, die weder zu sprechen noch Blickkontakt aufzunehmen hinkriegt und deshalb ganz sicher in einer betreuten Wohngruppe lebt.
Wenn wir allein ins Krankenhaus mit einem Krampfanfall eingeliefert wurden, dann wurde uns immer vermittelt, wir hätten uns nicht genug um Hilfe bemüht.
Nun waren wir Begleitung eines als helfend kategorisierten Menschen und entnehmen aus dem Brief, dass wir als jemand wahrgenommen wurden, di_er keine Hilfe mehr braucht, weil ja schon Hilfe da ist.
In “Die Soziologie der Behinderten” beschreibt Günther Cloerkes (unter anderem) wie so etwas passiert.
Es passiert aus Angst vor dem selbst gemachten und gelebten Tabu der Nonkonformität, die Behinderung und behindert sein bedeutet.
Wenn wir so sind – wann immer wir so viel Not durchleben und das nicht verstecken (können/wollen) – erschrecken wir Menschen, denn sie merken, wie wenig es braucht, um so wertlos/krank/ausgeliefert/leidend/bedürftig/* zu werden, wie sie uns gerade wahrnehmen und in was für eine prekäre Lage sie sich selbst mit allem, was sie in Bezug auf uns tun, manövrieren.
Es tröstet und entlastet, wenn man die Wurzel einer Behinderung in einem Menschen bzw. dessen Psyche oder Gehirn verorten kann. Es tröstet und entlastet, wenn man sich mit der Idee von einem “guten Platz für einen nicht so richtigen richtig normalen alle belastenden Menschen” ent.sorgen kann.
Was es mit uns macht, wenn wir diesen Menschen ihre Strategien immer wieder kaputt machen müssen, weil sie Bullshit oder nicht die Realität sind, bleibt dabei unbedacht.
Wie viel Kraft es uns kostet bei anderen (ablierten) Menschen das Unbehagen zu lösen, die Unsicherheit zu nehmen, zu versprechen, jederzeit alle möglichen Fragen zu klären und all diesen Extraservice zu stemmen, den es braucht, damit ablierte™ Menschen uns als “ganz normal” unter sich dulden – danach fragt niemand.
Daran denkt scheinbar auch niemand.
Und ja, ich finde das scheiße. Ich finde das richtig scheiße.
Und ich finde mich scheiße, weil ich das gerne könnte. Immer und für alle.
Kann ich aber nicht immer.
Weil ich eben doch eine Person bin, die ist, wie sie ist. Traumatisiert. Viele. Autistisch.
Und leidend.
Mal mehr mal weniger.
Mehr, wenn wir Tage wie gestern in eine Zeit, wie die der letzten Wochen und Monate integrieren müssen. Weniger, wenn wir genug Entlastung durch gute Hilfen haben, die an uns herangetragen werden, ohne dass wir bitten und betteln, fordern und kämpfen müssen, sondern, weil man versteht, was wir sagen.
Ich mag solche Jammerpostings nicht. Würde auch lieber einen kessen Spruch nach dem anderen bringen und zeigen, dass unser Leben nicht nur grau in schwarz in Not und Elend ist.
Aber manchmal ist es das.
Und dann wäre es schön zu spüren, dass das gesehen wird. Es wäre schön, sich damit nicht allein gelassen zu fühlen.
Es wäre schön gewesen, hätte man uns im Krankenhaus helfen können.
Es wäre schön gewesen, hätten wir an diesem Tag von vornherein jede Hilfe haben können, die wir gebraucht hätten.
Es hätte uns allen so viel erspart.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …