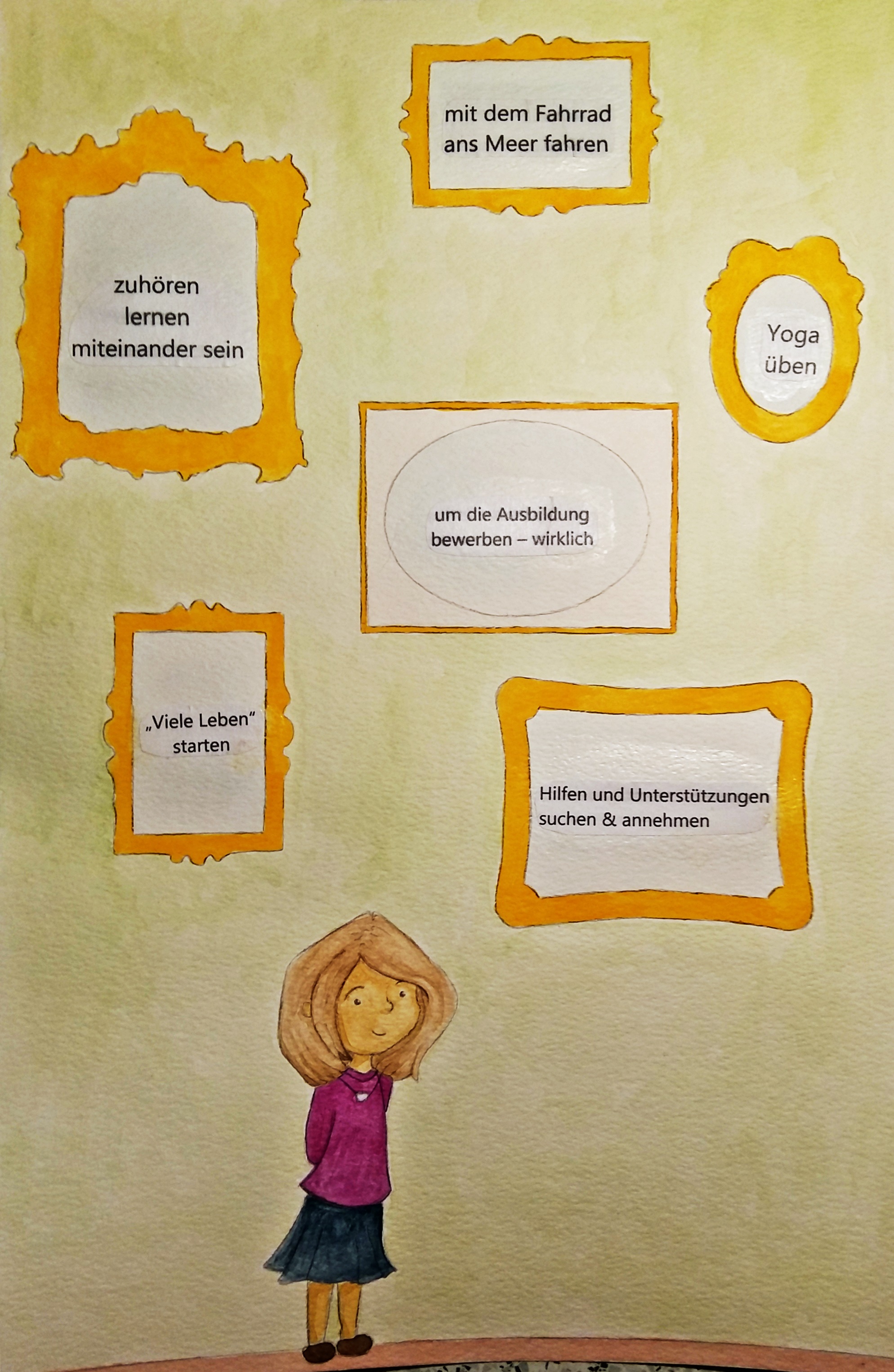Schlagwort: positive Ressourcen
Ausblick #1
24. 12. 2015
In diesem Jahr haben wir gelernt, dass es in Ordnung ist, wenn man auf einem Foto nicht einfach abbildet, was angesehen werden soll, sondern immer genau das, was man selbst sieht und sehen möchte.
Erst das Zeigen eines Bildes bedeutet seine Teilung.
Harry Potter und sein Täterintrojekt
Harry Potter quält sich mit der Frage, ob er vielleicht so wird wie Voldemort.
Er spürt Ähnlichkeiten, Verbindungen, bemerkt an sich fremdartig globale Aggressionen nachdem er Zeuge der Tötung eines seiner Mitschüler durch Voldemort wurde.
Well, das ist die Stelle, in der ich meine Brille gerade rücke und mich frage, warum es in der Zaubererwelt eigentlich eine Kenntnis von Wahnsinn und verwirrtem Verstand gibt, doch nicht von PTBS und Täter_innenintrojekten. Die Filme selbst verraten es mir.
Das Rezept ist Freundschaft, Liebe, ein Ziel für das sich zu kämpfen lohnt und die Erkenntnis, dass der frei umhermordende Täter sich durch Magie in den Kopf des Opfers genistet hat, um etwas davon zu haben.
Harry du alte Lusche – kontrolliere halt deinen Geist! Lass das nicht zu! Kämpf halt noch ein bisschen mehr. Retraumatisiere dich und lass uns das zum heldenhaften Kampf erklären.
Oh my.
Versteht mich nicht falsch – es ist nichts falsch daran sich um Freundschaft, Liebe und Ziele im Leben zu bemühen, wenn man schlimme Dinge erlebt hat. Es wird halt tricky, wenn die Person, die verantwortlich für diese schlimmen Dinge ist (oder war) zum immerwährendem und alles bestimmenden Zentrum im Leben der Person, die zum Opfer geworden ist, wird.
Da gibt es verschiedene Arten, wie sowas passiert.
Auf der einen Seite ist die Angst der Person, die zum Opfer wurde vor der Macht und der Person selbst, die die Integrität und Autonomie dieser Person verletzte, einschränkte und/oder zerstörte. Man kann nicht ignorieren, wovor man Angst – manchmal auch Todesangst – hat.
Viele Strategien gegen solche Ängste haben etwas mit Vermeidung oder Gewalt zu tun.
Vermeidung hat folgendes Problem: „Denk nicht an einen rosa Elefanten“ – Woran hast du gedacht? ba da bamm
Gewalt zeigt sich in Aktionen wie: „Dem zeig ichs jetzt“ – wem zeigst du jetzt mal und mit welcher Berechtigung? ba da bamm
Auf der anderen Seite sind die Freunde, Angehörigen, Verbündenten und die vereinigte Helfersfront auf Basis einer angenommenen Opfernot und Gerechtigkeitsstreben.
„Du musst kämpfen!“ – „Lass dich nicht unterkriegen!“ – „Wenn du jetzt aufgibst, hat di_er gewonnen!“ – „Si_er ist es nicht wert sich zu ärgern/zu grämen/schlecht zu fühlen/mit ihm_ihr zu befassen!“ – „Vertraue nur uns – dann bist du sicher!“
Da passieren gewaltvolle Ansagen und oft ist überdeutlich, wie schrecklich gut gemeint sie alle sind. Was will man dagegen sagen? Was kann man sagen, ohne den Kontakt zu gefährden? Wie viel Gegenrede ist in Ordnung? Wieviel Autonomie ist mit Hilfen und Unterstützungen vereinbar?
Häufig verändern sich Kontakte nach Gewalterfahrungen. Viele brechen weg.
Meistens, weil es schwierig ist miteinander zu reden und zwar mit sich selbst, seinem Empfinden und seinem Erleben im Zentrum und dem Ereignis im Kontext, das die Person, die eine Täterschaft zu verantworten hat, an genau dem einem Platz beinhaltet, der noch genug Raum für die Kontexte lässt, in denen sich diese Person bewegt (hat).
Sehr viele Menschen fangen an schreckliche Ereignisse und die Beteiligten zu versachlichen oder gänzlich zu abstrahieren. Deshalb schreiben wir zum Beispiel häufig von „DAS DA“ und „ES“ in unserem Leben.
Das Grauen wird dadurch für uns zwar fassbar (hey-es sind immerhin drei Worte!) und spiegelt doch sowohl die eigene Unfähigkeit nach einem Ereigniss, das jeden Erfahrungs(und Verarbeitungs)rahmen sprengt, es konkret zu erfassen (und zu verarbeiten), wie das Empfinden von Grenzen- und Raum- und Zeitlosigkeit, sowohl in der Situation selbst, als auch häufig genug noch darüber hinaus.
Wenn wir in Workshops sind, kommt die Frage öfter, was man denn richtiger machen könnte.
Gerade, wenn wir dann gerade lang und breit darüber gesprochen haben, welche Sprachführung nicht sinnvoll und am Ende sogar opferfeindlich ist.
Wir raten oft dazu sich selbst zu prüfen und zu schauen, was genau die Erfahrung der zum Opfer gewordenen Person mit einem selbst macht. Was genau wünscht man der Person und warum?
Wieso ist es wichtig, dass es ihr so schnell wie möglich wieder gut geht – ging es der Person vor dem Ereignis denn „gut“ oder erscheint es jetzt aktuell „gut“, weil es ihr nun sehr schlecht geht? Und wieviel Reflektionsleistung kann der Kontakt miteinander eigentlich aushalten?
Was zum Beispiel passiert, wenn man wie Harry Potter gleiche und ähnliche Eigenschaften an sich entdeckt, wie die Person, die einem schwere Nöte angetan hat?
Wenn wir in den Spiegel sehen, finden wir die Mutterfrau. Wenn wir uns dabei ertappen, wie wir uns an einen Türrahmen lehnen, erkennen wir das Warten des Vatermannes.
Wenn NakNak* zum x-ten Mal Katzenscheiße im Garten frisst, brandet ein gleißendes Wüten bis an die Wurzel meiner Zunge hoch und ich merke, wie ich sie verletzen will. Da ist kein Gedanke, keine Überzeugung, kein Wort hinter, das mir sagt:“Oh – hei ich bin ein Täterintrojekt und hier eine Gewalt zu wiederholen – mach mal Platz“.
Das ist pure Energie, die durch eine dumpfe noch nicht greifbare Erinnerung angestoßen wird – aber das wissen wir erst seit ein paar Jahren (NakNak* kam erst danach).
Zu Beginn hatten wir wenig bis keine Kompetenz diesen Energiestoß überhaupt zu erfassen, geschweige denn zu bremsen oder zu kontrollieren.
Das hat uns letztlich zu einer nicht tragbaren Jugendlichen gemacht. Wir waren ein böses Mädchen. Eine Gewalttäterin*. Klar musste man uns „ordentlich bestrafen“ – „so, dass wir es auch begreifen“ – „auf, dass wir nicht denken, wir wären wer“ und selbstverständlich musste man handeln, um sich selbst zu schützen.
Und während unser hochprofessionelles Außenrum uns behandelt hat wie der letzte Dreck, war alles in uns bestätigt, was uns erst zu Handlungen brachte, die uns zum „bösen Mädchen“ machten. Wer so böse ist, dass Erzieher_innen einem Privatsphäre, Ruhe und Unversehrtheit vorenthalten, di_er hat genau dies allem äußeren Anschein nach wohl auch nicht verdient.
Bis heute weiß ich nicht, wie wir je von allein auf die Idee hätten kommen sollen, dass dieses plötzliche Kippen in Selbst_Verletzung, Zerstören von Beziehungen, Ver_Bindungen und anderen Dingen, die uns wichtig sind, etwas mit den Übergriffen zu tun hatten, die wir erlebten und bis heute auf anderen Ebenen erleben.
Auch wenn es oft irgendwie schräg bis lächerlich klingt – bitte liebe Menschen – unterschätzt das nicht, wenn Menschen mehrfach diskriminiert sind und jeden Tag mit diversen Formen der Unterdrückung (Gewalt) konfrontiert sind. Es ist die gleiche Mechanik. Es sind die gleichen Muster. Es ist das verdammt noch mal immer und immer und immer Gleiche.
Auch wenn kein Blut fließt oder keine Strafanzeige erstattet werden kann. Auch dann!
Es frisst sich rein und bricht als Selbst_Zerstörung wieder raus.
Die Einen kotzen, hungern, schneiden sich auf – die Nächsten verletzen andere Menschen, machen Werbung auf Kosten anderer und wählen die AfD, während die Letzten vor lauter „denken sie nicht an…“ die Kunst des Eskapismus perfektionieren und aus allen Wolken fallen, wenn sie mit Menschen konfrontiert sind, denen Dinge geschahen, die unfassbar sind.
Manchmal isolieren sich Menschen, die Schlimmes erlebt haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie niemand versteht. Dass niemanden ihren Kampf um Kontrolle versteht. Dass niemand ihre Angst versteht.
Und leider haben sie oft auch noch das Pech, dass sie wirklich nicht verstanden werden, weil die Personen drum herum auf Dinge achten oder von Umständen oder Empfindungen ausgehen, die nicht in den Personen wirken.
Herrje, wie oft Menschen uns für ein zartes Seelchen halten, das aber doch unfassbar stark sein muss, weil sonst hätte es ja nie überleben können.
Tse – wir haben überlebt, weil wir überlebt haben. Wir hätten auch das stärkste Menschlein auf der Welt sein können und unser Risiko zu sterben wäre gleich groß gewesen.
Wir verbinden mit unseren Gewalterfahrungen nicht solche Wabbeldinge wie Würde oder Ehre und wir fragen uns auch nicht, wer uns denn jetzt noch nehmen wollen würde.
Wir hängen uns oft an einem „hätte würde wenn“ auf, weil unser Zentrum nicht andere Menschen, wohl aber unsere Pläne in Abhängigkeit von anderen Menschen sind.
Das ist zum Beispiel , was das Finden von Triggern für uns sehr leicht macht – aber auch Aufhänger liefert, in denen wir uns in Gedankenkreiseln wieder finden, die sich damit befassen wie oft man hätte den linken Fuß auf dem Fußabtreter hätte reiben müssen, bevor man die Wohnungstür öffnete oder damit, welche Wörter wann wie warum genau falsch waren. Über solche Dinge denken wir stundenlang nach und machen uns darüber selbst Stress.
Und natürlich kann man wenig produktiv über andere Dinge nachdenken, wenn man solche Schleifen im Kopf hat, auf der Suche nach dem ultimativ sicheren Plan für immer und ewig, auf das nie wieder irgendjemand käme und uns verletzte.
Weil der ultimative Plan ja auch dafür sorgen würde, dass wir keine Gefahr darstellen – unabhängig davon, wieviel Täter_innenintrojekte in uns wüten und wieviele Monster an ihren Käfiggittern reißen.
Manchmal denke ich, dass die Annahme des eigenen Bösen in sich einfach genau das ist, was niemand von Ex-Opfern hören will.
Es ist so bequem davon auszugehen, dass eine Person immer und grundsätzlich gut ist, weil so der Umstand der Ungerechtigkeit der an ihr begangenen (Straf-)Tat stärker hervorsticht.
Als wären die Menschen vor dem Gesetz (und für manche Menschen auch: vor G’tt) nicht gleich.
Würde, Ehre, Gewollt sein – das hat alles mit der Gesellschaft zu tun, die für uns als Einsmensch irgendwie immer eher wie wissenschaftlich interessantes bis nervenaufreibendes Beiwerk an uns vorbei geblubbert ist. Wir haben die Erwartungen dieser Gesellschaft nie erfüllt und werden das vielleicht auch nie schaffen.
Für manche Menschen macht uns das zu einem Menschen, dessen erlebtes Unrecht nicht das gleiche Unrecht ist wie für eine Person, die ihr Leben lang beliebt unter „den Richtigen“ und „erfolgreich an der richtigen Stelle“ war. Glücklicherweise nicht für viele – aber für genug, dass ich mich daran erinnerte, als wir gerade „Harry Potter und der Orden des Phönix“ schauten.
Ich habe daran gedacht, wie ich mir vielleicht 2 – 3 Jahre früher jemanden gewünscht hätte, di_er mir erklärt, was Täter_innenintrojekte sind und was die Introjekte oder auch Innens sind, die mir helfen könnten mit ihnen so umzugehen, das weder wir noch andere Menschen unter ihnen leiden.
Und ich dachte, wie schade es ist, dass Harry nur zu hören bekam: „Mach deinen Geist frei“, statt: „Mach deinen Geist mit den Dingen voll, die das Böse in dir gleich groß wie alles andere in dir macht, denn es gehört auch zu dir.“
an einem “Alles ist möglich-Tag”…
… klingelt der Wecker nicht zur üblichen Zeit und das drei Mal hintereinander, damit sich auch wirklich alles im Kopf daran erinnert, dass heute alles anders ist als sonst.
Widerwillig lässt sie den Donnerstagsplan los und stellt sich unter die Dusche. Nimmt uns vielleicht als Spur im Rauschen des Wassers wahr, kann uns vielleicht sogar hören, wie wir ihr sagen, dass sie nicht allein ist. Dass auch dieser „alles-ist-möglich-Tag“ bedeutet, dass wir uns so eng wie es nur geht nach vorn stellen und niemand etwas allein aushalten, abfangen, tragen, stemmen, fühlen, wahr_nehmen muss.
Wir entscheiden 2 Minuten vor dem Verlassen der Wohnung, dass NakNak* uns nicht begleiten wird. Nicht zum Gespräch über das betreute Wohnen in Familien und auch nicht zur Therapie danach. Weil sie so süß eingekringelt auf ihrem Platz liegt und aus müden Knopfaugen guckt, als wir sie noch einmal anschauen.
Und, weil es vielleicht doch zu viel “alles ist möglich” ist, wenn sie mit uns im Therapiezimmer ist. Und, weil wir überwiegend wir allein sein müssen, wenn es um unsere vielleicht zukünftige Betreuung geht.
Die Sonne geht in einem kräftigen altrosa-grau auf. “Shabby chic” denke ich und erinnere mich an unsere letzte Nachbarin, die mich dafür bezahlt hatte ihre Möbel weiß und elfenbeinfarben zu lackieren und dann abzuschmirgeln.
Damals. Vor über 3 Jahren. Als wir noch betreut wurden und soweit am Rand der Stadt wohnten, dass das Internet seinen Platz als einziges Verbindungsstück zu anderen Köpfen bekam.
Es ist halb 9 und wir entscheiden uns für einen Kaffee vom Bäcker. 1,89€ für eine bittere Brühe, deren gratis beigelegter Plastikbecher und Plastikdeckel und Plastiksahnepöttchen und das Plastikumrührstäbchen wahrscheinlich bald im Bauch einer Meeresschildkröte oder Pelikans wieder auffindbar sind. Wir diskutieren auf dem Weg zur Verwaltungsstelle über Plastik aus Maisstärke und schlimme Bodenerosionen durch den massenhaften Anbau von Mais, während sie überlegt, dass Popcorn auch mal wieder lecker wäre und genüsslich das Plastikumrührstäbchen ablutscht.
Wir kennen das Büro. Vor 7 oder 8 Jahren standen wir dort schon mal und dachten Wunder was wie erwachsen wir seien, dass wir aus der Jugendhilfe in die Hilfen für junge Erwachsene wechselten. Und eine unserer Gemochten bis heute kennenlernten.
Sachte fliegen Erinnerungsfetzen an die letzten Botschaften Befehle von Täter_innen an uns vorbei. Die Erinnerungen an NakNak*s wundergut flauschiges Welpenfisselfell und die Zeit mit ihr, zwei Katzen, einer Mäuse- und einer Guppyzucht und ihrem Problem draußen in der städtischen Hölle ihr Geschäft zu machen.
Wie viel wir damals noch geraucht haben. Wie schlimm alles damals noch war und doch so viel besser als alles vorher.
Eine freundliche Person spricht mit ihr über das betreute Wohnen in Familien.
Wir wissen schon alles und dann und wann berühren wir ihre Schulter um ihr zu signalisieren, dass sie aufhören kann, die auf sie einströmenden Wörter abzufangen. Wir erwarten Fragen zu uns und unserem Hilfebedarf. Erwarten die schlimmste aller Fragen, die jemand, der uns Hilfen zukommen lassen möchte, stellen kann: “Was wünschen Sie sich?”.
Die Frage kommt und wir drehen eine Vermeidungsschleife bis die Person die Frage als beantwortet denkt, obwohl sie das nicht ist.
Wir verabschieden uns mit einem zweiten ekelhaften Kaffee und einer zweiten Zahnschmerztablette im Bauch und einem Fragebogen zur individuellen Betreuung und Begleitung im betreuten Wohnen in Familien. Ein bisschen schwankend unter dem Gewicht einiger Kinderinnens und deren Schmerz.
Wir entscheiden uns die Sonnenseiten der Straßen zu benutzen. Entscheiden uns für den köstlich langen Bergabzebastreifen, er entlang eines großen Parkplatzes verläuft und streicheln eine weiche schwarze Labradormischlingshündin an der Straßenbahnhaltestelle.
“Ich glaube, dass wir eine gute Familie für Sie finden”, hat die Person gesagt und vielleicht gibt es wenig, das uns so unvermittelt umkrempeln kann, wie so ein Satz, der all die positive Belegung des Begriffes “Familie” im Ton hat.
Wir bedauern sie, diese Menschen, die versuchen uns damit zu zeigen, dass wir auf einem guten und tatsächlich auch gangbaren Weg sind. Sein könnten.
Wir bedauern sie, diese Menschen, deren kostbares Geschenk einer Familie wir nur ratlos anschauen und mit Roman- oder Fernsehinhalten abgleichen können.
Während wir eine halbe Stunde verbummeln, spielen wir mit einer gefundenen Feder. Betrachten die perlmuttartigen Schimmer der feinen Lamellen im Sonnenlicht und balancieren auf dem Kiel dazwischen umher.
Ein Kleines wedelt mit der Feder in der Luft herum spürt den Widerstand wie ein leichtes Pochen in den Fingerspitzen. Wir sind abgeschirmt von allem und fast nicht mehr da. Einfach so. An einem “alles ist möglich-Tag” kann man mitunter auch einfach mal so verwabern und im kalten Streichelwind, der über Federkiele weht, verschwinden.
Unsere Therapeutin hat vor ein paar Wochen beschlossen, dass wir jetzt eine Weile Tee trinken und wir haben noch immer kein so wirklich passendes Regal dafür gefunden.
Entsprechend grabscht sie blindlinks in unsere Bäuche, Rücken, Schultergelenke um an ein Wort für ein Gefühl, um das sie sich nicht sicher ist zu kommen. Sagt am Ende, sie glaubt traurig zu sein.
“Verstehen Sie das?” fragt die Therapeutin. “Nein.”, antwortet sie.
“Was würden Sie gern tun?”, fragt die Therapeutin. “Ich würde gerne weinen und was essen und dann eine Schmerztablette nehmen und dann…” und dann verheddern sich ihre Außenworte mit den Trümmern der einstürzenden Worttürme links und rechts und unserem ungeordnetem Aufbranden.
5 Minuten später essen wir einen überraschend ekelhaften Jogurt und eine beruhigend nette Banane. In dem Zimmer von unserer Therapeutin. Weil ja zum Glück “alles-ist-möglich-Tag” ist. Nur Anlass – kein Grund zur Panik.
Auch nicht, als ein Kinderinnen ihr sagt, dass es lieber bei ihr oder bei einer Gemögten oder dem Menschen wohnen würde, als in einer “Familie”. Und Familie*.
Auch nicht als da jemand sitzt, den wir bisher für körperlos hielten.
Wir laufen am Ende doch er_leichter_ter als vorher nach Hause und hopsen von Bratwurstduftwolke zu gebrannte Mandelndunst. Lassen Tauben den Vortritt und trampeln mit Absicht auf die Linien zwischen den Mustersteinen, die die Fußgängerzone einrahmen.
Beobachten wie sich die Weichen der Straßenbahn verstellen und warten zwischen zwei silbernen Bodenlinien. In all dem Menschenkrach wollen wir dann doch nicht auf unseren Einzelsitzplatz am Fenster verzichten.
Sie zittert etwas und wundert sich noch ein bisschen. Betastet das eigene Herz und versucht “Traurigkeit” unter den Fingerspitzen zu emp_finden.
Zu Hause wartet NakNak* auf uns und drückt ihren Nüschel in unseren Bauch, als wir unseren Nüschel auf ihren Kopf drücken.
Wir geikeln zwischen den Sonnenstrahlen und ihrer restlichen Wärme herum, kitzeln Grashalme und krabbeln von Gänseblümchenblüte zu Gänseblümchenblüte. Veratmen Erinnerungen an Familie*, an Es und DAS DA, legen die ausgeatmeten Eiterbröckchen dieser Wunden in die geheimen Wortloskatakomben. Aus den Augen aus dem Sinn.
Die nächste Station ist unsere Neurologin. Zwei wichtige Zettel und ein Stand der Dinge.
Weil “alles ist möglich-Tag” ist schaffen wir es um eine Verordnung für Ergotherapie zu bitten, die Einweisung für die Klinik zu regeln UND auch noch alle vorgestrickten Wörterketten zu sagen ohne uns zu verheddern, obwohl NakNak* neben uns sitzt und sich vorher im Wartezimmer in einen schrecklich hungrigen Gierlappen verwandelt hat.
Als wir in den Kreativmarkt gehen und NakNak* sich zum zweiten Mal auf die falsche Seite setzt, merken wir auch deutlich, wie lange es her ist, dass wir sie auch unter Menschen und inmitten von vielen Menschen als unsere Assistenz dabei hatten. Wie oft da die Angst ist unangenehm aufzufallen, dem komischen angesprochen werden, dem Ganzen „für ein Wesen außerhalb auch noch verantwortlich sein“, wir uns nicht gewachsen fühlen. Wie oft wir uns behindert haben, um keine Behindertensperenzchen von anderen abzuverlangen.
Langsam geht die Kraft zur Neige und wir machen nur noch eine Ehrenrunde durch den Park. Dort gibt es einen Schwarm mit winzig kleinen Vögelchen, die ganz wunderbar niedlich qwitschermiepen. Und zwei Hündinnen, die gerne mit NakNak* über die Wiesen flitzen. Und Sonnenstrahlen, die uns einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn kitzeln, bevor sie sich mit Abenddämmerung zudecken.
Wir haben “Görpower-Toni”- Karten von der Post abgeholt. Auf dem Weg dorthin eine orange-weiße Katze wie einen Stein auf dem Fußabtreter eines Haus sitzen sehen.
Die Welt zittert in ihren Fugen.
Wir telefonieren mit Renée und finden unser letztes gemeinsames Podcast ein bisschen gut und freuen uns darüber, dass eine zuhörende Person schon etwas recherchiert hat.
Und dann fangen wir an unseren Tag zu erzählen.
Wer hätte denn ahnen können, dass wir den schaffen?
Es wäre doch alles möglich gewesen!
Momente
Oft kommt es ja nicht vor, dass ich mich bei Personen, die mich und mein Tun für scheiße und falsch halten, für irgendwas bedanken könnte– aber heute kann ich da mal eine Ausnahme machen, weil ich an meinen Aufruf erinnert wurde, ob es jemanden gibt, der Interesse daran hat mich gegen eine meinen Möglichkeiten entsprechende Dienstleistung bzw. ein Produkt von mir, zu unterstützen zum Inklusionscamp in Hamburg zu können.
Geplant war mit den Sommers zusammen hin zu fahren und erstmals eine Episode zu produzieren, in denen es um Inklusion und Behinderung geht. Das sollte fast ein klitzebisschen wie Radio werden. Hach. Aber das war eh ne blöde Idee, weil redaktionelle Inhalte der Impressumspflicht unterliegen. Und tja.
Ist ja dann auch eh alles kaputt gegangen.
Aber es gab damals eine Einzelperson, die uns genug Geld zur Verfügung stellen konnte, damit wir hinfahren konnten.
Die “Gegenleistung” sollte ein Moment sein. Ein Moment in Hamburg, ein Moment im Camp.
Das fand ich zu schön um es wegzuschmeißen, nur weil es, als es dann soweit war, bedeutet hat, allein in Hamburg unterwegs zu sein. Nach einer Diagnose, die uns zerrissen hat, nach einem Kontaktabriss, der nicht nur schmerzhaft, sondern allgemein mit überfordernden Emotionen wie handfesten Problemen rund um Viele-Sein einherging. Nach so viel Schmerz, der es nie bis hier ins Blog geschafft hat, sondern immer wieder in massive Selbstverletzungen.
Wir fuhren also zum Camp mit einer Idee zu einer Session und all den Gefühlen, die mit zu unserem “anderen Hannah C Rosenblatt-Leben” gehören.
Irgendwie ist es eben doch ein anderes Leben, das mit dieser Rolle , innerhalb derer man sich vor anderen Menschen sprechend befindet und auf eine Art “an” sein muss, wie man sie im Alltag schlicht nie ist, verknüpft ist.
Man hat eine Visitenkarte, ein kleines Portfolio und ansonsten nur seinen mit allem möglichen vollgestopften Kopf und spürt wie groß das Gefälle zwischen den Zuhörenden und einem selbst ist. In dem Moment, in dem es still wird, ist alles Erbrechen, sich aufschneiden, den Kopf gegen die Wand knallen, das Bluten und Rotz aus dem Kopf quellen spüren weg. Das gibt es nicht mehr. Man ist sauber, gefasst, kühl, von sich distanziert. Das ist eine dieser Ebenen, in denen man depersonalisiert ist und über sich selbst spricht und so tut als wäre es jemand anders.
Und daneben schlackert die Panik, dass man sich vertut, nicht die aktuellsten Zahlen hat, einen Satz sagt, der sich widerspricht. Dass man wirr ist. Dass man unverständlich spricht. Dass jemand aufsteht und einen ausschimpft. Dass man im Außen das “Kritik”inferno erlebt, das man im Innen hat.
Im Barcamp durften wir eine Ahnung davon bekommen, wie das ist, wenn diese Panik sich einen Stuhl suchen darf, weil sie ein total okayer Teil ist.
Barcamps haben es an sich eine Veranstaltung zu sein, bei der es das Gefälle zwischen Sprechenden und Hörenden nicht in der Form zu geben braucht. Alle sind Teilgebende – wer sein Thema nicht als Session anbietet, der wird es nicht in der Veranstaltung haben. Wer sich Dinge anhört, die nicht gefallen, di_er hört Dinge, die nicht gefallen, weil sich nicht für etwas anderes entschieden wurde.
Das Team hinter dem Inklusionscamp war total freundlich und offen, was ich auch schön fand.
Manchmal kommt man ja doch in Versuchung diejenigen, die eine Veranstaltung auf die Beine stellen irgendwie zu othern – ich hab das an mir nicht festgestellt und fand das schön.
Vom Camp selbst gibt es inzwischen übrigens eine Dokumentation und hier und da kommt noch was über den Twitteraccount.
Ich hoffe sehr, es kann ein zweites Inklusionscamp geben. Dann vielleicht mit einem weniger auf inklusives Lernen gerichteten Schwerpunkt und mehr auf inklusiven Alltag und wie die individuellen Wege und Vorstellungen so sind.
Wir haben uns dagegen entschieden im Camp zu fotografieren, weil wir zu viele Menschen hätten ansprechen müssen und das nicht leisten konnten.
Aber wir haben den Sonnenaufgang von der Dachterrasse der Jugendherberge an der Horner Rennbahn aus fotografieren dürfen.
(Die Story dahinter, die auch den desaströsen Aspekt der Heimfahrt vielleicht etwas mehr verdeutlicht: Wir schliefen in einem 6er-Zimmer so gg 23 Uhr ein und wachten gg 1? oder 2? Uhr morgens auf – und hatten dann Angst, wenn wir einschlafen würden, würden wir den Wecker um 4 nicht mehr hören, weil die Rennbahn doch ein ganzes Eck (und ein Verkehrsproblem) weiter weg vom Camp war.
Wir uns also hin und hergewälzt, wie die ganzen wirrschlimmen Gedanken und Probleme jener Zeit und dann irgendwann um 4 aus dem Schnarchezimmer raus. Der Nachtportier hatte uns dann gefragt wos hingehen wird und wir so: “Och wir suchen uns jetzt nen hohen Punkt und gucken mal, ob wir noch den Sonnenaufgang kriegen.” – ohne den blassesten Schimmer, wo ein solcher sein könnte selbstverständlich – Fotos machen Rosenblätterstyle … ähem
Der hat uns dann jedenfalls auf die Dachterrasse gelassen, wo wir dann ohne Stativ und entsprechende Objektive mit der analogen Kamera gearbeitet haben.
Es war arschkalt – aber toll.
Auch so einer dieser Momente …)

Ein anderer Moment war am Hamburger Hauptbahnhof. All die Freiwilligen, die geflüchteten Menschen helfen.
“Mein G’tt.”
Das hab ich die meiste Zeit gedacht, wenn ich wieder jemanden mit Neonweste durchs Gewühl drängen sah – im Schlepptau ein Grüppchen mit Kinderkarre, Kleinkindern auf dem Arm und dieser einen Angst im Gesicht, die irgendwie nach den Worten kommt.
Ich bin dankbar, dass es die Helfenden gibt. Ich kann diese Art der Unterstützung nicht leisten. Weiß aus meiner Art der Hilfe- und Unterstützung von Menschen, dass es mehr abverlangt, als Gerenne und Übersetzung. Sehr viel mehr.
Ein Moment war auch jemandem die Hand zu halten, den man eigentlich – irgendwie – nicht kennt und doch nah ist.
Ich glaube, dass war der “der Moment”, den wir aus Hamburg damals mitgenommen haben.
Wir haben an allem, was mit dem Inklusionscamp zusammenhing, viel Wertvolles gelernt.
1) es ist legitim und okay, wenn man sich Sponsoren der eigenen freien Arbeit auch über Twitter sucht
2) Inklusive(re) Veranstaltungen sind machbar – das Camp ist uns selbst ein gutes Vorbild dafür
3) ein Stativ ist nie “zu schwer/zu sperrig/unnötig” um es auf Reisen mitzunehmen
4) auch die, die man für Profis hält, lernen jeden Tag
5) jedes Mitdenken von Personen, die anders sind, als man selbst, ist das, was man “inklusives Denken” nennen kann
6) Hannah C. Rosenblatt kann auch mal genau mitten in einer Gruppe sein, ohne unangenehm anders zu sein
Herbstfreuden…

Nebenwirkungen
Die Sonne scheint, die Welt glüht in satten Farben und verstärkt etwas in mir, dass zwischen gehetztem Tier und wirren Gedankenstrudeln pendelt.
Ich bin gestern spazieren gegangen. Trug eine kleine, rein mechanische, Plastikkamera von circa 1977 umher und versuchte ein paar Aufnahmen.
Ich merkte, wie meine Fingermuskeln sich unwillkürlich verkrampfen, genauso wie ich es an meinem Gesicht am Tag vorher bemerkt hatte.
Da spiele ich Hasch-mich mit meinen eigenen Wahrnehmungen und rede mir ein, dass es nicht passiert, wenn ich nicht darauf achte und werde von meinen bisher nie registrierten Bewegungsroutinen auf den Boden der Tatsachen zurück geholt.
Mein Spaziergang wird zum Kampf um Motive, Licht und Schatten, Kontrolle und Bewusstseinsunterdrückung.
Kaum zu Hause angekommen, könnte ich gleichzeitig ins Bett fallen, wie einen bizarren Spitzentanz auf einem Trampolin beginnen. Meine lange Muskulatur in den Beinen versteift sich wie Holzlatten an meinen Knochen entlang und schert sich keinen Deut um meine Angstspitzen, die es nicht in greifbare Panik schaffen.
Später sagt Renée am Telefon “Ja, das Seroquel muss weg.” und in meiner Zustimmung hockt doch die Angst, es im Moment aber auch nicht aushalten zu können ungedämpft vor dem zu sein, was mit miruns passiert.
Da sind wirre Erinnerungsfetzen, die sich mit abstrusen Träumen vermischen, die Anspannung vor dem Workshop am Freitag in Dresden und den ersten Stunden wieder allein mit NakNak*.
Und November und alles.
Und alles und alles und alles.
Und der Gedankenschrei “Bitte nicht”, der nicht einmal ein Satzzeichen hat, weil er allem gleich entgegen treten muss und mehr Varianz nicht mehr geht.
Die Neurologin rief vorhin an, wegen des Termins, um den ich bat. Gab mir einen für Mittwoch dessen Uhrzeit ich verloren habe. Wörter sind Räume, Zahlen sind Striche. Striche gehen so schnell verloren in diesem klebrigwattigen weißen Rauschen zwischen Wahrnehmung und Rezeption.
Ich bin auf eine Art so nah vor dem Loslassen, das mich reaktiv aufzucken lässt ohne planvolles Handeln zur Folge zu haben und gleichzeitig so fern davon, loslassen zu können, weil alles in mir hart ist.
So hockte ich mich am Abend unter meinen Schreibtisch unter die Bettdecke und spulte meinen Film zwischen der Angst auf dem Sprung, eine Berührung von etwas außerhalb der Decke zu spüren und der Angst, dass sich der Film wieder in der Spule verhakt und ich das Negativ mit den Fingerspitzen berühre, während ich versuche ihn gut wieder einzuziehen, auf, nur, um in einen echten Flashback zu rutschen, als ich, in der Bewegung unter der Decke hervor, die Orientierung verliere.
Aber wir sind ja Ressourcenmeister_in. Man hält ja durch. Seinen Happy-PTSD-Pokal bekommt man nur, wenn man trotzdem weitermacht.
Und es dann halt verkackt, weil man macht um zu machen und nicht um das Machen bewusst, gezielt und konzentriert wahrzunehmen. Wie ichwir.
Und heute?
Scheint die Sonne, glüht die Welt und summt es noch immer unerträglich in all meinen Zellen.
Alles noch mal neu.
Weil es diese Sehnsucht gibt nach etwas, das daneben noch klappt. Etwas, was ganz konstant immer gleich funktioniert und kein Hasch-mich-Spiel erfordert.
Es ist die Suche nach der Konstanten im Chaos und dem, was hilft zu überleben.
Birds of Paradise
this is SO cool
*____*
kleine Nachteule

unser zweites Bild im Rahmen der Challenge #Inktober
Macht jemand von euch auch mit?