Nur noch 11 ein halb Tage bis zum Termin beim Betreuungsdienst der Wahl.
Getriggert ist inzwischen so ziemlich fast alles und wie Unkraut es so an sich hat, schießt das Zeugs im Kopf in alle Richtungen.
Es ist ein Moloch, den wir da vor uns sehen und das nicht, weil unsere Erfahrungen alle eher so semi bis grotte mit Aspekten von zart glitzerndem Wow waren.
Sondern, weil Betreuungen immer zwischen Kontexten der Wohlfahrt, wahrhaftiger Selbstlosigkeit, des schieren Kapitalismus und Not auf vielen Ebenen passieren.
Auf Flyern lachen die Menschen immer. Oder lächeln. Es gibt gegliederte Texte, frische Farben, samtweißen Hintergrund und fast sind selbst die Paragraphen am Ende der letzten Seite nicht schlimm.
Mit Beginn der Arbeitsgruppe “das Nachwachshaus” und im Verlauf unserer Krise haben wir eine ganze Menge von diesen Flyern angesehen und gelesen. Im Laufe des Jahres und mit zunehmendem Engagement in Sachen “Inklusion als Menschenrecht”, konnten wir uns diese Flyer aber auch mehr und mehr dekodieren und in einen Kontext mit unseren eigenen Wahrnehmungen und Einschätzungen in Bezug auf geschehene Betreuungen (und all die geschehenen Nichtbetreuungen) bringen.
Vor uns kann kein sozialpädagogisch arbeitender Mensch mehr stehen und sagen: “Ja aber…” oder “Was erwartest du denn?” und anderes reflexhaftes Derailing anbringen.
Sorry – not sorry.
So, wie wir lange vor der Krise schon darüber schrieben, dass keine einzige Form der Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun, kontextlos passiert, so schreiben wir nun über Betreuungen als einen Aspekt der Gewaltenverteilungen und ihren Aus-Ein-Mit-Wirkmechanismen.
Die Wohlfahrt und ihr gesamtes System gehört zu einem Teil der Gewalt, die Menschen mit Behinderungen/Behinderte, Arme, Kranke, Unterstützungs- und Hilfebedürftige jeden Tag erfahren und gegen den sich zu wehren praktisch unmöglich für sie ist, ohne sich selbst einer sehr existenziellen Gefahr auszusetzen.
Klar könnte ich in eine Kommune irgendwo auf dem Land ziehen und schauen, ob meine Probleme sich von veganer Lebensweise, frischer Luft und absoluter Abschottung vom Rest der Welt verbessern. Für manche Menschen kann das ein Ding sein.
Für mich aber nicht. Und wieso sollte ich als Person, die sowieso schon unglücklich mit dem ständigen Außenseiter_in sein ist, außergerechnet als totale Aussteiger_in glücklich sein?
Um klar zu sein: ich suche keine Hilfen, die weder institutionalisiert sind, noch komplett außerhalb kapitalistischer Kontexte passieren. Wir leben im Kapitalismus und wir leben in einem System, das Strukturen eher anerkennt als fluide Existenzen. Deshalb ist der Mensch allein hier ja so wenig wert.
Aber, ich möchte nicht von Menschen betreut und unterstützt werden, die selbst, (und nicht zuletzt auch wegen der Arbeit an/mit mir) zu Personen werden, die Hilfe und Unterstützung brauchen, um am Leben sein zu können.
Ich möchte das zum Einen nicht, weil ich das für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit halte und zum Anderen, weil ich mich entwickeln möchte. Vielleicht auch an Beispielen und Vorbildern entlang.
Heimlich ist das ein Wunsch. Okay. Vielleicht ein naiver. Obwohl eigentlich nein. Die Glitzeraspekte von selbst den semihilfreichen Betreuungen, die wir so hatten, waren Menschen, die etwas an sich hatten/haben, das wir (bis heute) nicht verstehen und deshalb zu ergründen versuchen: die mochten uns und wollten uns helfen, weil “einfach so”.
Für uns ist das wie ein Ding, das aus dem Weltraum kommt.
Nicht, weil wir das gar nicht kennen, dass Menschen uns sagen, sie mögen uns – viel mehr, weil die meisten Menschen, die uns sagen, sie würden uns mögen, uns in Wahrheit einfach genau nur so lange mögen, wie ihre Vorstellungen und Erwartungen an uns erfüllt sind.
Wir sind so schlecht darin Erwartungen zu erfüllen. Vor allem, wenn die Menschen nicht einmal reflektieren, dass sie welche an uns haben oder herantragen. Dann merken sie oft nicht einmal, dass wir sie enttäuscht haben – dann merken sie nur, dass wir anstrengend, unverständlich, zeit-nerven-kraft-intensiv im Umgang sind.
Gerade Letzteres tut uns immer wieder weh zu merken. Und auch deshalb sind wir inkompatibel mit ambulantem betreuten Wohnen.
Da heißt es im Hilfeplangespräch, dass man sich in Ruhe um alles kümmert und sich auseinandersetzt und dann macht.
Am Ende sieht die Realität dann so aus, dass die Klientin vor mir einen Amtstermin hatte, der – konnte man ja nicht ahnen – länger dauerte – für mich also bedeutet 20-30 Minuten weniger Zeit mit der betreuenden Person zu haben, weil sie nach mir noch schnell einen Klienten vom Bahnhof drei Dörfer weiter abholen muss und der da ja nun nicht so lange warten soll (was er dann aber doch muss, weil ich nervigerweise vielleicht doch noch ein Problem geklärt haben muss, das schon seit fünf vorherigen Terminen geklärt werden will, die furioserweise alle ähnlich gequetscht und zeitlich ultraeng aussahen).
Klar seufzen Betreuende vor mir auf und sagen mir, dass sie schon viel Zeug heute hatten und grad ne Migräne anrollt und Fußschmerzen und das Auto ist ja auch fast kaputt und so ein langer Tag noch heute…
Na klar tun sie das. Weil sie Menschen sind und keine Maschinen.
Aber die Erwartung ist eine Reaktion von mir.
In meiner letzten ambulanten Betreuung hatte ich den Standartreaktionsspruch auf das “Uff- ist alles ganz schön viel” von meiner ehemaligen Therapeutin kopiert und blindlinks abgespult, während hinter mir natürlich alles durcheinander getriggert herumpurzelte und sich überlegte, wie man die Probleme, die eigentlich in aller Ruhe mit den betreuenden Personen angeguckt werden sollten, selbst klärt.
Ich hab mich dafür geschämt, als ich das gemerkt hab. Ich mag selbst keine vorgefertigten Sätze hören und mache das dann in solchen Situationen.
Warum? Weil ich überfordert bin. Weil ich keine Kraftreserven dafür habe Menschen individuell mit Lautsprache zu berieseln. Weil die soziale Interaktion schon total viel Kraft kostet. Weil sich den Problemen, bei deren Lösung ich Hilfe und/oder Unterstützung brauche, zu stellen Kraft zieht.
Weil es bei meinen Problemen immer und immer wieder um handfeste existenzielle Absicherungen bzw. den Verlust dessen dreht.
Wir haben die ambulante Betreuung verlassen, weil wir gemerkt haben, dass wir diese Kraft nicht mehr aufbringen konnten.
Muss man sich mal überlegen – eine Hilfe ablehnen, weil man keine Kraft für sie hat.
In anderer Menschen Leben würde das bedeuten, sich mehr Hilfen ranzuholen.
Aber dann – mehr Hilfen ranholen. Mehr einfordern, als eine Person, die eh schon immer zu viel ist. Zu viel kognitiver Aufwand. Zu viel Zeit-Kraft-Energiefraß.
Obwohl sie doch auch super alles allein geschafft hat. Weil sie das ja doch gar nicht anders wollte.
Am Ende ist es halt dieser Dreh, der uns vor ein paar Wochen das Genick gebrochen hat.
Die Erkenntnis, dass wir Marathon laufen und eigentlich einen Rollstuhl bräuchten. Das ist ein mieser Schlag in den Bauch und doch irgendwie typisch für unsere Reflektion und permanente Dekonstruktion der Blicke anderer auf uns. Wir sind nicht zimperlich oder die Art Person, die sich die netten Aspekte von Reflektion auf sich herauspickt und die bitteren Stücke liegen lässt.
Wir suchen die bitteren Stücke, weil sie in der Regel wahrhaftiger sind. Schmerz ist ehrlich. Schmerz ist unbestechlich. Schon immer gewesen.
Menschen, die uns weh tun, erleben wir als ehrlicher und sehr viel offener, als Menschen, die immer nur Honig für uns haben.
Leider sind Menschen, die uns weh tun, häufig auch selbstsüchtige Arschlöcher oder von Täter_innenintrojekten angestochene Hörnchen und deshalb nicht besonders geeignet für uns im täglichen Kontakt.
Und damit sind wir wieder bei den dauerlächelnden Prospektgesichtern für Betreuungsanbieter.
Es gibt die Angst in so einer furchtbar netten Umgebung zu landen, in der wir die einzige Person sind, die Kritik übt, Dinge kritisch betrachtet, Negatives auch offen kritisiert.
Es gibt die Angst wieder reinzufallen auf irgendein Lächelgesicht und Versprechen auf entspanntere Aussichten, die dann doch nie kommen.
Und es gibt die Erinnerungen, die heute noch einmal auf einen anderen Boden fallen. Heute turnen teilweise 12-13-14 jährige Innens in unserem (Schul/Bildungs-) Alltag herum und ich merke, wie wir Rosenblätter anfangen sie zu merken. Was es ausmacht, wenn Worte wie “Es gibt eine Bekleidungspauschale und Verpflegungsgeld…” fallen. Das ist kein Teil unserer Jugend, der verarbeitet ist.
Wir wissen nicht, wie man sich betreuen lässt.
Wir wissen nur, wie es ist betreut zu werden und sich kaputt zu machen, während man versucht die Betreuenden zu entlasten und sie möglichst nicht mit der Hölle in einem drin in Berührung kommen zu lassen.
Wir schauen gerade nach einer Alternative zum stationären Wohnen in einer Wohngruppe.
Also denken wir gerade allen Ernstes darüber nach, uns irgendwie mehr als 4-6 Stunden pro Woche mit Menschen in Kontakt zu bringen. Und zur Berufsschule zu gehen. Gleichzeitig.
Wir.
Like: wirklich wir oder ein frisch aufgekeimter Blob irgendwo am Rande des Temporallappens?
Im Moment fühlt es sich für mich an, wie parasuizidale Ideen. Ernsthaft.
Es fühlt sich an, als würden wir uns mit der Umsetzung dieser Idee von Hilfe und Unterstützung an eine Art Suizid bringen, den keiner außen merken würde, weil wir ja gut versorgt wären und so.
Es ist auch eine ähnlich einsame Entscheidung.
Oder?






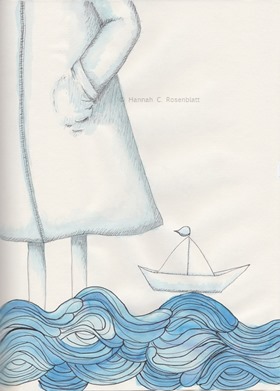 Und dann ist es doch wieder eine Zeit, in der ich in einen Telefonhörer hinein sage: “Ich weiß ja auch nicht, was ich bei der Frau Doktor soll. Meine Therapeutin hat gesagt…”
Und dann ist es doch wieder eine Zeit, in der ich in einen Telefonhörer hinein sage: “Ich weiß ja auch nicht, was ich bei der Frau Doktor soll. Meine Therapeutin hat gesagt…”