Inklusion ist radikal.
Wer sie fordert, fordert, dass sich die Welt verändert.
Die Welt.
Also, alles.
Like: Ja wirklich, so richtig alles, was man kennt.
Inklusion ist unmöglich in einer Gesellschaft, die von *ismen, also abgeschlossenen, sich selbst am Leben erhaltenden, Wertkonzepten definiert wird.
Mir ist das klar. Aber vielen, vielleicht auch den meisten, anderen Menschen nicht.
Nicht einmal vielen behinderten Menschen. Nicht einmal den öffentlichkeitswirksam aktiven behinderten Menschen.
Und ja, das ist nicht hilfreich, wenn man die Inklusion aller Menschen will.
Hatte man sich zu Integrationszeiten noch hinstellen können und einfach den neuen Begriff erklären können, so ist es heute üblich, nach der Inklusion zu fragen. Zum Beispiel setzt sich Charlotte Zach im Online-Magazin „Die neue Norm“ mit der Frage auseinander, wie inklusiv Instagram ist und wie sie sich als behinderte Frau dort darstellen kann, um viele Menschen zu erreichen, ohne jedoch dabei zu wirken, als wäre sie keine behinderte Frau, weil genau das oft schlechter ankommt und zu weniger Reichweite beiträgt.
Ihr Text endet mit dem Entschluss für einen Mittelweg, was sich kaum neoliberaler und einer gesellschaftlichen Mitte gefälliger lesen lässt, als ein lapidares „You do you.“ und also nicht taugt für radikale Weltveränderung.
Die Systemfrage wird nicht gestellt – es wird die Frage gestellt, wie man sich als behinderte Person ins System hineinfügt.
Ein Problem für behinderte Menschen – für eine Gesellschaft, die kein aufrichtiges Interesse an der Inklusion aller Menschen haben muss, weil sie von der Exklusion profitiert, hingegen nicht.
Natürlich wird Inklusion und alles, was der vermeintlich nicht behinderte Mainstream dem Begriff zuordnet, auch nach wie vor erklärt. Mitten im Schwung von #AbleismTellsMe veröffentlichte Sukultur das Leseheft „Ableismus“ von Tanja Kollodzieyski, ihres Zeichens @Rollifräulein bei Twitter – und Initiatorin des „Satireprojektes“ „Nichtbehinderte und ihre Freunde“ (@nebhis_friends). Ein Account, der die Plattitüden und Mikroaggressionen, mit denen sich behinderte Menschen täglich konfrontiert erleben, auf vermeintlich nicht behinderte Menschen ummünzt. Ein harmloser Witz, ein Ventil für Frust über die eigenen Benachteiligungen als behinderte Person, der pfiffige Versuch Aggressoren mal zu zeigen wie das ist, wenn man so angesprochen wird, damit sie mal darüber nachdenken, dass sich etwas ändern muss – so wird der Account von vielen wahrgenommen und gefeiert.
Unter den Accounts, die Futter für den Account lieferten: Rebecca Maskos. Autorin des bei der Edition F erschienenen (ebenfalls bemerkenswert erklärbärerischen) Textes „#AbleismTellsMe: Behinderte Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen“, mit dem im Zusammenhang mit dem Tweet zum „Satireprojekt“ doch ganz bemerkenswerten Satz: „Das Ideal des voll einsatzfähigen, autonomen, nichtbehinderten Menschen kann niemand wirklich erreichen – und dennoch ist es so wirkmächtig, dass wir uns alle danach ausrichten.“
Der Satz deshalb interessant, weil er wahr ist. So wahr, dass ich hier in meinem Büro saß und in Tränen ausbrach, weil die medial breit hörbaren Stimmen meiner Themen um Behinderung und Inklusion offenbar nicht eine Sekunde lang reflektiert hatten, dass sie mit ihrem „umgedrehten Spieß“-Spässken gerade genau das taten: sich nach dem Witz der Überlegenen, der Wirkmächtigeren ausrichten. Für Likes, für Spaß, für ein oberflächliches und absolut folgenloses, weil eben nicht gleichermaßen wirksames Stückchen vom Machtkuchen. Für dieses kurze Moment der Verbundenheit, weil man die Sprüche kennt und die Gefühle, die sie auslösen, schon zigfach durchlebte.
Das Problem: Gleichstellung ist nicht das Gleiche wie Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung allein bedeutet immer noch keine Inklusion in einer Gesellschaft, in der Gesetze von Autoritäten gemacht, gesichert und durchgesetzt werden.
„Wie du mir, so ich dir“ löst kein einziges Problem, ja, benennt es nicht einmal. Tatsächlich braucht es dieses Problem, um als Witz überhaupt verstanden zu werden.
In meiner ersten Kritik nannte ich den Account einen „reverse-ableism“-Witzaccount und verzichtete bewusst darauf, @Rollifräulein zu konfrontieren. Sie und auch sonst niemand, die_r zu dem Ding beiträgt, ist in meinen Augen das Problem und ich möchte auch nicht, dass meine Kritik darauf runtergebrochen wird. Das Problem ist, dass die Beiträge, die Likes, die Retweets, die Replies, das Gefühl der Verbundenheit und des „endlich mal was bewegen“-Eindrucks bei dieser Art von „Witz“ kommen und nicht bei Forderungen, Kritiken, Ideen, Vernetzungsaktionen, die explizit und ganz konkret einen Wandel der Politik, der Gesellschaft – der Welt, in der wir alle miteinander leben müssen, weil wir alle auf eben dieser Welt leben – in Gang setzen wollen oder könnten.
Auf meine Kritik reagierten etwa 5 Leute mit einem Like. Zwei schrieben mir in ihren Replies, warum der Account legitim sei. Mit ableistischer Logik. Natürlich.
Ich schrieb nichts mehr. Schaltete @Rollifräulein stumm, damit ich nicht 50 mal am Tag denke, sie hätte irgendetwas kaputt gemacht oder würde alles zerstören. Denn das ist einfach nicht wahr.
Ableismus, Mehrheitsdenken, „abled supremacy“, ausbleibende Herrschaftskritik, jeder *ismus und sich daraus ergebende Diskriminierungen zerstört alles. Es zerstört nicht nur den gemeinsamen Grund, auf dem wir einander verbunden fühlen und sein könnten, es zerstört auch alle Möglichkeiten, miteinander Konsens zu entwickeln und einander zu Macht zu verhelfen.
Es zerstört jede Möglichkeit auch nur in die Nähe von dem zu kommen, was der Begriff „Inklusion“ meint.
Inklusion ist radikal.
So zu handeln wie Leute, die sich für nicht behindert halten, ist es nicht. Es ist vielmehr die Weiterführung dessen, was Inklusion verhindert.
Das muss sich ändern.
Radikal.
 Paula Puzzlestücke
Paula Puzzlestücke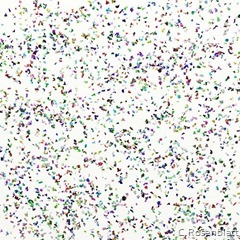 Nach jedem Artikel über häusliche Gewalt, über PartnerInnen*schaftsgewalt, gibt es mindestens eine Stimme, die davon redet, dass sich eine Partei als Opfer präsentiert.
Nach jedem Artikel über häusliche Gewalt, über PartnerInnen*schaftsgewalt, gibt es mindestens eine Stimme, die davon redet, dass sich eine Partei als Opfer präsentiert.