“Auch Jennifer Freyd hat ein wichtiges Buch zu diesem Thema geschrieben. Sie ist die Tochter der Eltern, welche die False Memory Syndrome Foundation gegründet haben, eine international sehr mächtige pressure group von angeblich zu Unrecht des Missbrauchs bezichtigten Eltern. Jennifer Freyd hat ihre Eltern nie öffentlich angeklagt. Die Eltern sind in die Offensive gegangen und haben eine Stiftung ins Leben gerufen, die ausschließlich mutmaßliche Täter verteidigt und mit sehr viel Geld eine pseudo-objektive, tatsächlich aber opfer-diffamierende Öffentlichkeitskampange finanziert.”
[aus “Wege der Traumabehandlung” v. Michaela Huber]
Im Blog von Paula und Co gibts heute einen Artikel zur FMSF, den ich wichtig finde, weil er sich an HelferInnen* und UnterstützerInnen* richtet, die sich mit der Frage befassen, ob denn wahr sein kann, was sie von Menschen erfahren, die von Gewalt berichten.
Es gibt wenig klar umrissene Punkte über die sich so offen (salonfähig, gesellschaftlich (heimlich) akzeptiert) opferfeindlich geäußert werden kann, wie mit der Frage nach der Wahrheit der Ereignisse, die jemanden offiziell zum Opfer erklären, denn Wahrheit, ist etwas, das zu definieren sehr schwer ist. Vor allem, weil sie etwas anderes als Fakten ist.
Die meisten Menschen, mit denen ich mich über rituelle und sexualisierte Gewalt unterhalten habe und, die selbst nicht diese Erfahrungen machen mussten, dachten, sie fragten sich: “Ist das denn wahr?”.
Sie würden diese Ereignisgewalten als wahrhaft anerkennen, wenn sie sie selbst (mit)erfahren hätten, oder wenn diese Ereignisse reproduzierbar wie Umstände wäre, die Fakten hervorbringen. Es sich also um etwas wie das Phänomen handelte, das Wasser zu Eis verwandelt, wenn man es in den Froster stellt.
Letzteres ist noch eine sehr junge Art Wahrheit zu betrachten und findet ihre Ursprünge darin, dass Wissenschaftler(Innen* – es waren erst einmal nur Männer, was mit dem Patriarchat in dem wir Menschen im Westen leben (bis heute!) zu tun hat ) als Personen gelten, die Wahrheiten erforschen und Glauben(sinhalte) widerlegen bzw. berichtigen. Darauf könne man sich verlassen, denn Wissenschaft sei objektiv.
Nun ist es aber so, das nichts objektiv ist. Objektiviert, ja. Objektifiziert, ja. Aber so etwas wie “die Objektivität” gibt es nicht. Kann es gar nicht geben, weil jeder Mensch auch Subjekt seiner eigenen Wahrheit, Ergebnis seiner eigenen Sozialisierung und gesellschaftlicher, wie auch kultureller Konvention ist.
RichterInnen* sprechen kein Recht, weil sie die Wahrheit objektiv erfasst haben, sondern weil es Gesetze gibt, für das, was die unparteilich richtende Person aus dem, was ihm die klagenden Parteien schildern, gemäß der eigenen Lebensrealität und daraus folgend: seiner eigenen Wahrheit, zu rezeptionieren fähig ist. Gleiches gilt für AnwältInnen* und nicht juristische FürsprecherInnen*.
Wenn ich mit Menschen über die Schilderung von Gewalt anderer Menschen spreche, dann sage ich, dass es sich immer und in jedem Fall um die Wahrheit der Menschen handelt und frage nach, ob sich die Frage nach der Wahrheit bzw. der Wahrhaftigkeit auf Fakten bezieht, oder darauf, vor etwas zu stehen, das nicht mit der eigenen Wahrheit (die sich aus einer bestimmten Lebensrealität speist) in Verbindung zu bringen ist.
Meistens sagen die Menschen dann, dass es tatsächlich mehr darum geht, dass für so furchtbare Ereignisse absolut kein Anknüpfungspunkt in der eigenen Lebensrealität gesehen wird und es deshalb schwierig ist, die Wahrheit anderer Menschen anzuerkennen.
Ich habe aber auch schon mit Menschen gesprochen, die nichts von eigenen Wahrheiten halten. Was für diese Menschen zählt ist “Objektivität”, was in aller Regel Fakten in Form von Studien- und Untersuchungsergebnissen meint und ganz eigentlich sogar nur eine Sicht meint: die es gut situierten, weißen, heterosexuellen Cis-Mannes (mittleren Alters), auf dessen Blick auf die Welt, sämtliche westliche Forschung aufbaut und aus dessen Wahrheit heraus sich die Mähr der Objektivität überhaupt erst hat entwickeln können.
Irgendwann ist es einfach passiert: aus der weißen männlichen Subjektivität, die mittels Wissenschaft hinterfragt und/oder bewertet werden sollte, wurde urmännliche Objektivität, die fortan zur Wahrheit im Gewand des Faktes auftreten sollte.
Es gibt diesen einen global blinden (obwohl heute oftmals schon einmal angeleuchteten) Fleck in der Wissenschaft und zwar Gewalt bzw. Diskriminierungen
Je kleiner und unfähiger zur Bildung einer allgemein wahrnehmbaren Masse, die zu untersuchende Gruppe ist, desto wahrscheinlicher wird diese nicht in den Genuss kommen, ihre Lebensrealität und die daraus entstehenden eigenen Wahrheiten in Form von Fakten abgebildet zu sehen.
So entstehen zum Beispiel gerade im Bereich der rituellen Gewalt, die mit explizit antichristlicher Ideologie durchzogen ist, einerseits Anerkennungsdynamiken in unserem christlich kultivierten Land, gleichzeitig aber genau auch nur daraus resultierende Blindheit für zum Beispiel christlich fundamentalistisch motivierte rituelle Gewalt, oder die Rezeption dieser Art Gewalt, als ein Angriff auf “die Grundwerte” Deutschlands. Da geht es in der Argumentation dann sehr schnell darum zum Beispiel satanistischen Kulten eine antidemokratische Haltung zuzusprechen, auch wenn solche Kulte sich selbst vorgeblich als lediglich antichristlich wahrnehmen und (zu recht) aufgrund der “Trennung” von Kirche und Staat in unserer Demokratie™ als nicht an staatliche (demokratische) Werte gebunden.
Das gleiche Muster ist in Bezug auf sexualisierte Gewalt (an Frauen und Kindern) zu finden.
Einerseits wird anerkannt, dass es Vergewaltigungen und Verletzungen von Personen aufgrund ihres Genitals und das daran geknüpfte soziale Geschlecht gibt- andererseits gebietet es die Abwertung dieses sozialen Geschlechtes “Frau” und der Adultismus, der sich auf Personen unter 14 ergießt, diese Verletzungen nicht selbst beurteilen zu können.
Die Definitionsmacht liegt in Bezug auf Personen, die als Frauen angesprochen werden darauf, das eine der Objektivität (und eben nicht dieser hysterischen Subjektivität) verpflichteten Person (am besten (cis-)männlich, mit Macht und Würde) diese physischen (genitalen) Verletzungen (etwas anderes zählt nicht, weil Psyche individuell und ergo nie mit 100%iger Sicherheit in objektive (wahrhaftige) Kategorien pressbar ist) als existent und ergo geschehen und ergo wahr markiert.
Bei Kindern ist es tendenziell jede Person, die erwachsen ist oder als erwachsen gelesen wird.
Gruppierungen wie die false memory syndrome foundation machen sich genau diese Diskriminierungsdynamiken zu eigen. Und zwar zum Einen, weil sie es (aus Gründen) wollen und zum Anderen, weil sie es können und zwar mit wenig Aufwand und unter Einbeziehung der gesamten westlichen Kultur, die die Wissenschaft als (einzigen) Wahrheitsträger, Wahrheitsfinder und Wahrheitsdefinierer anerkannt hat.
Interessenvertretungen wie die FMSF bilden keine pressure groups, weil sie basierend auf Fakten eine große Gruppe von Personen, die zu Unrecht angeklagt/ angezeigt werden darstellen [vgl. hierzu die polizeiliche Untersuchungskommission von New York, 1974 und die Untersuchungen zu Falschanzeigen von Vergewaltigungen in Deutschland von Volk, Hilgarth und Kolter 1979, die zu dem Schluss kommen, dass nur 2% falsche Anzeigen waren – ergo 98% aller Meldungen Anzeigen sexualisierter Gewalt tatsächlicher Taten sind], sondern, weil sie es schaffen die anzeigende Person nicht offen eine/n/* LügnerIn* zu nennen.
Das false memory syndrome wurde genau dazu erfunden, die Glaubwürdigkeit von Personen, die durch ihr soziales Geschlecht und/ oder ihre gesellschaftliche Position in ebendieser bereits als abhängig von der Definitionsmacht überlegener Personen stehen, herabsetzend darzustellen und zwar über das Mittel der Pathologisierung und/oder dem sehr wirksamen Mittel der Deutung und Bewertung der Kontexte, in denen sich diese abhängigen Personen befinden.
So wird vertreten, das Psychotherapie Misshandlungsideen kreiere und die PatientInnen zu krank/so kognitiv dissonant/ zu ungebildet/ zu verwirrt sind, diese vom eigenen Erleben (und ergo Erinnern) zu trennen oder zu (emotional) abhängig von ihren BehandlerInnen sind, um diese Ideen eben nicht offen von eigenem Erleben (und Erinnern) abzugrenzen.
Ich komme nicht umhin einen Puls durchs Dach und einmal um den Erdball kreisend zu haben, ob dieser Unverschämheit, sich über die Wahrnehmung (und das subjektive Selbst) von Personen zu stellen, die sich in psychotherapeutische Behandlung begeben, und dem Implizit, dass PsychotherapeutInnen sich gezielt, um anderen Menschen (die sie nicht einmal kennen oder von deren Leiden sie selbst in irgendeiner Form profitieren, außer in ihrer Fantasie- was aber auch ohne den Aufwand der PatientInnenmisshandlung funktionieren würde) zu schaden, die Mühe machen, ihren PatientInnen irgendwas einzureden.
Ich vertrete die steile These, dass Menschen, die tatsächlich zu krank/so kognitiv dissonant/zu verwirrt/zu ungebildet sind, um fremde Ideen nicht von sich selbst zu trennen sind, ebenfalls nicht in der Lage sind, das Unrecht an sich zu erkennen, eine juristische Vertretung für sich zu finden, Tathergänge zu schildern, Beweise zu liefern, Anzeigevernehmungen und Klageverfahren durchzustehen. Nicht alleine. Nicht ohne, dass noch eine unbeteiligte Person noch mal und noch mal auf die Beziehung in der Psychotherapie zu schauen wagt.
Vor allem an dieser Stelle zeigt sich die unterschiedliche Wahrnehmung von Vorgängen rund um Lebensrealitäten von diskriminierten Personen, die zu Opfern von Gewalt wurden.
Was für ein einfaches Leben muss jemand haben- wie viele Erfahrungen von “ich sage etwas- dann passiert auch etwas und in aller Regel genau das, was ich will”, eine Person gemacht haben muss, um zu dem Schluss zu kommen: “Es muss nur einziges Mal jemand sagen: “Ich wurde von XY misshandelt” und zack landet XY im Knast (und es hat genau die Auswirkungen, die dieses jemand wollte)” , kann ich mir nur aus der Ferne überlegen.
Einige Kritik an der FMSF wird meiner Ansicht nach auch fehladressiert.
Es ist natürlich zu kritisieren, dass diese Gruppe propagiert, Erinnerungen könnten produziert werden und es gäbe nicht so viele Fälle von sexualisierter Gewalt, wie immer und überall geschildert – andererseits gibt es auch für das öffentliche Bild keinerlei Entsprechung für das Gegenteil. Und es ist nun einmal das öffentliche Bild, welches die Subjekte produziert, die dann “objektiv” richten/werten sollen.
Natürlich taucht mit schöner Regelmäßigkeit eine Studie auf, die uns Alarme schlagen lässt. Selbstverständlich gibt es inzwischen neurophysiologische Belege für die Phänomene um Dissoziation, PTBS und komplexe wie chronische Traumatisierungen, aber welchen Effekt haben diese blitzblank objektivierten Ergebnisse auf die Lebensrealität der Menschen im Alltag?
Wenn ich mich als Opfer von Gewalt mit meiner Expertise als Opfer von Gewalt in Fachkreise einbringen will, gilt diese Expertise nicht. “Zu individuell” heißt es dann. “Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Nicht wissenschaftlich genug”. Meine Gespräche mit HelferInnen*, JuristInnen*, RichterInnen*, BeraterInnen* und anderen Betroffenen gelten nicht etwa als fachliche Korrespondenz oder gar als Beratung.
Weil ich keine “objektive” Sicht habe, gilt sie nicht.
Sie gilt nur als Opferwahrheit und wird damit mehr oder weniger bewusst, abgewertet.
Als objektiv gilt, wer die Macht hat, seine subjektive Wahrnehmung um ein Objekt, als objektiv zu bezeichnen.
Deshalb ist auch der Anspruch an Menschen, die von anderen Menschen als FürsprecherInnen* oder BegleiterInnen* gewählt wurden, objektiv zu sein so falsch.
Dieser Anspruch zwingt MedizinerInnen*, JuristInnen*, (Psycho-) TherapeutInnen*, BeraterInnen*, Hebammen und überhaupt alle Menschen, die andere Menschen begleiten, in eine Position,in der sie selbst unter Umständen, Menschen beistehen müssen, die sie aber selbst verachten, ablehnen, abwerten und von ihren zu Begleitenden nicht als verachtend, ablehnend, abwertend handelnd markieren können.
Objektivität ist also auch ein Wegbereiter in das silencing – ins Wort- und Stimmlos machen von Personen, die sich an Personen wenden, um durch ihre Stimme gehört zu werden, weil es die Abhängigkeit der Personen voneinander zementiert und immer wieder zu einem Schauspiel um (Definitions)Macht führt.
Personen, die Gruppen wie die FMSF unterstützen, begründen ihr Engagement damit, dass sie wollen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Dass niemand zu Unrecht einer Strafe zu geführt wird.
Das ist toll und etwas, was unser Rechtssystem und auch unsere Gesellschaft wünscht und ergo unterstützt. Zum Beispiel in dem man “False Memory Deutschland” eine Gemeinnützigkeit anerkennt, weil diese keine StraftäterInnen* unterstützt und/oder schützt.
Dass sie dieses aber auf dem Rücken von tausenden Personen, die es aufgrund der von dieser Gruppe verbreiteten Falschinformationen und Ausnutzung bestehender Diskriminierungsstrukturen, nie und nimmer nicht überhaupt jemals auch nur in die Nähe von Sichtbarkeit und Anerkennung ihrer Lebensrealität als zu Opfer von Gewalt gewordenen Menschen schaffen, ist verabscheuungswürdig und ein Skandal, wie er nur in Kulturen passieren kann, denen eben jene Lebensrealitäten mitsamt der damit einhergehenden Subjektivität wertlos sind.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …
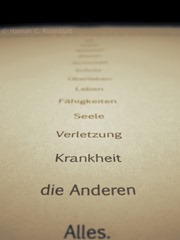
 “Seit in mir alles durcheinander brüllt und weint und schreit und krampft und zappelt, gehts mir so gut, wie lange nicht. “, dachte ich heute morgennacht, als ich auf meine Betäubung wartend im Bett lag und dem Hund beim Atmen zuhörte.
“Seit in mir alles durcheinander brüllt und weint und schreit und krampft und zappelt, gehts mir so gut, wie lange nicht. “, dachte ich heute morgennacht, als ich auf meine Betäubung wartend im Bett lag und dem Hund beim Atmen zuhörte. Paula Puzzlestücke
Paula Puzzlestücke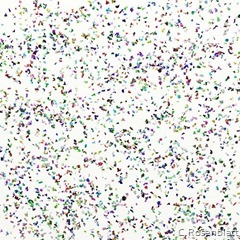 Nach jedem Artikel über häusliche Gewalt, über PartnerInnen*schaftsgewalt, gibt es mindestens eine Stimme, die davon redet, dass sich eine Partei als Opfer präsentiert.
Nach jedem Artikel über häusliche Gewalt, über PartnerInnen*schaftsgewalt, gibt es mindestens eine Stimme, die davon redet, dass sich eine Partei als Opfer präsentiert. Heute ist internationaler Tag gegen Kinderarbeit.
Heute ist internationaler Tag gegen Kinderarbeit.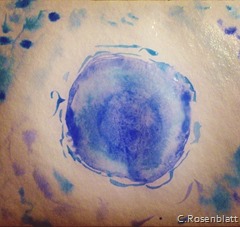 Ich habe über Protest nachgedacht. Über Nicht- Zustimmung und seine Folgen.
Ich habe über Protest nachgedacht. Über Nicht- Zustimmung und seine Folgen.